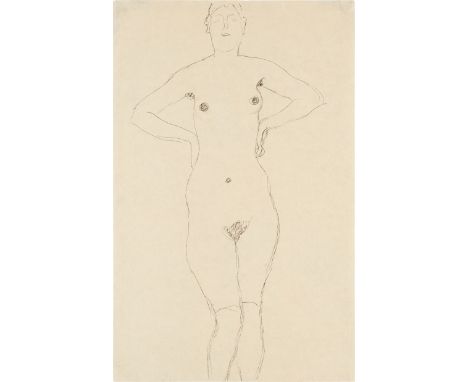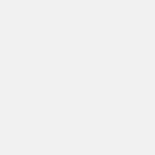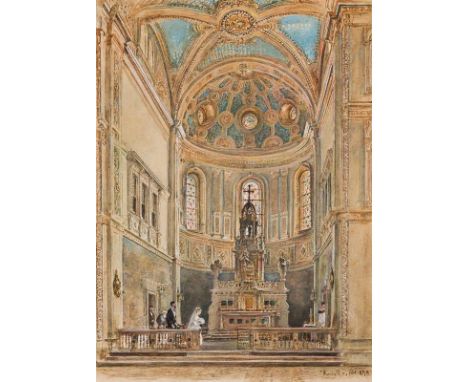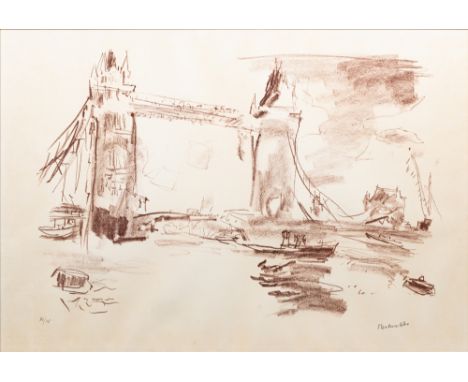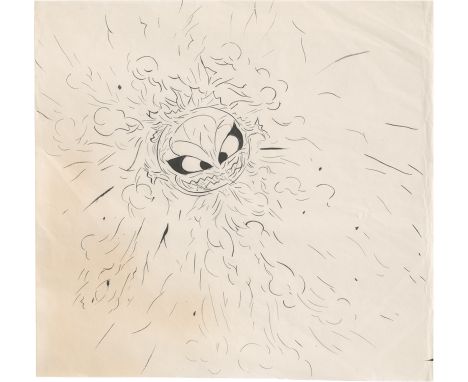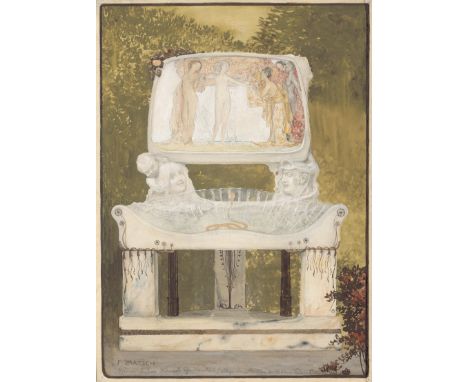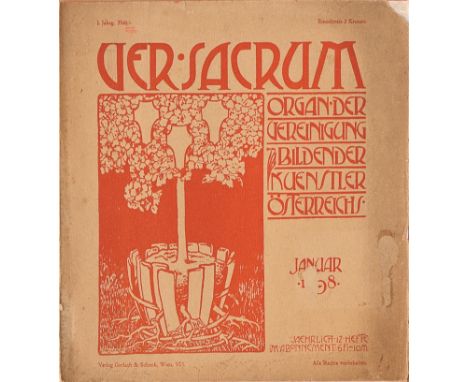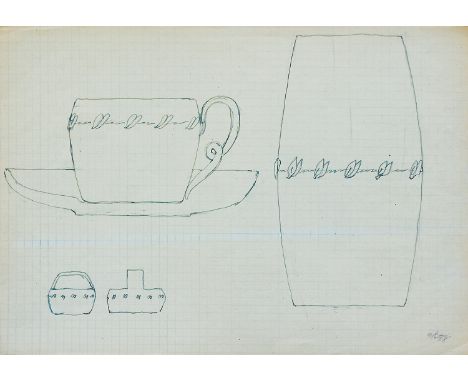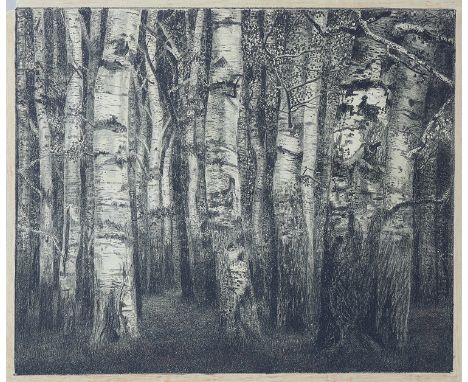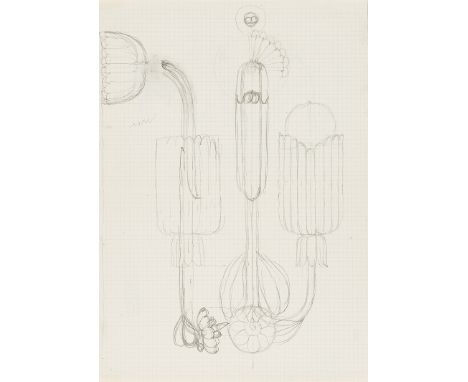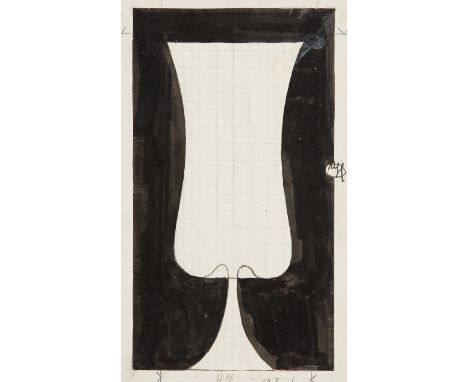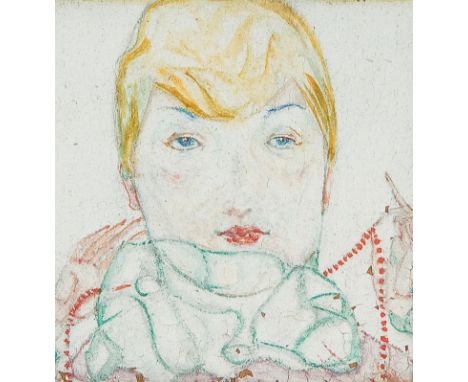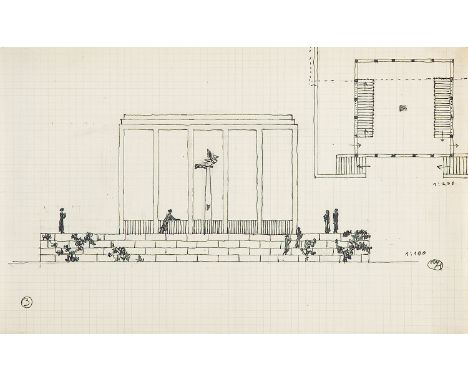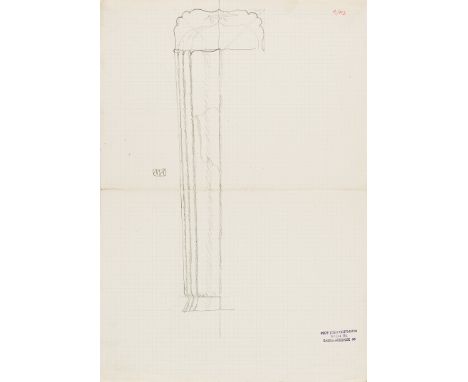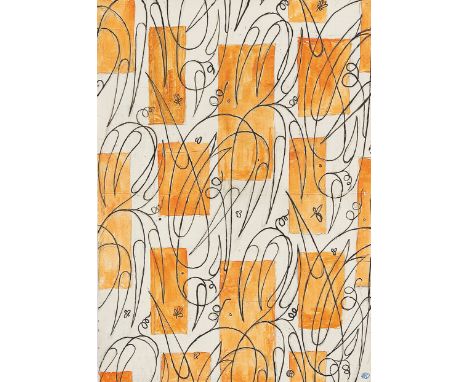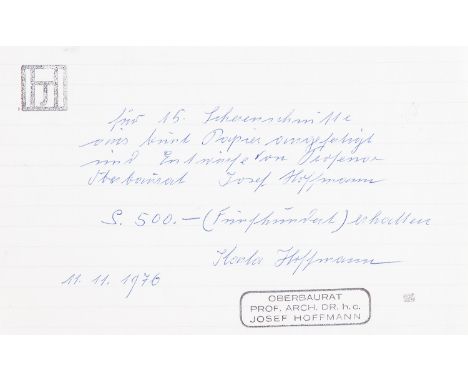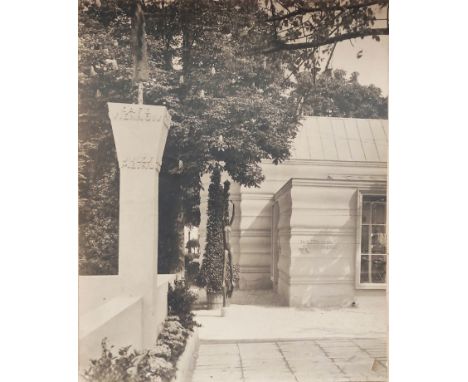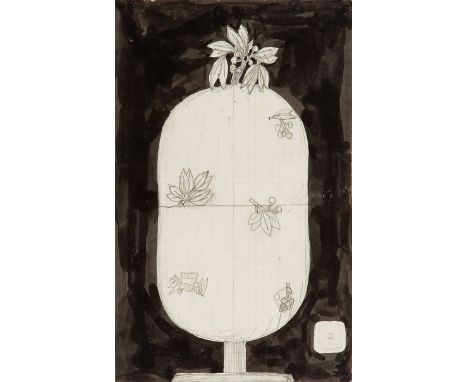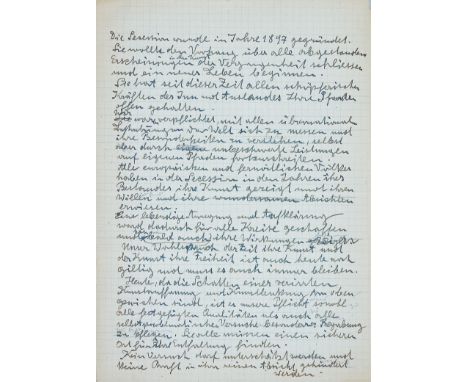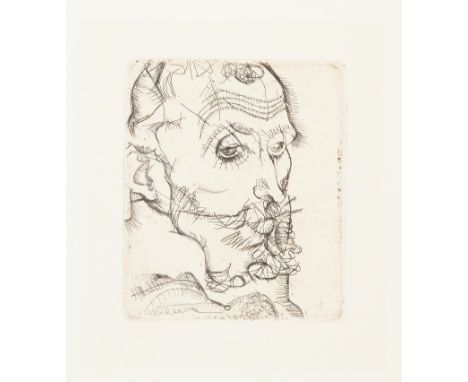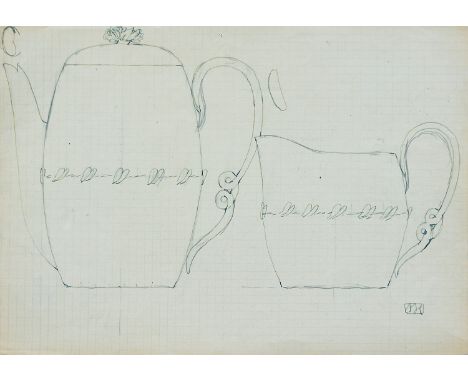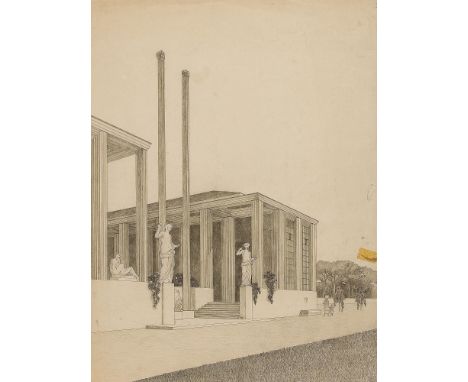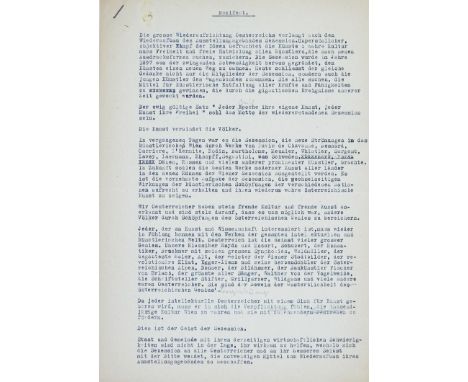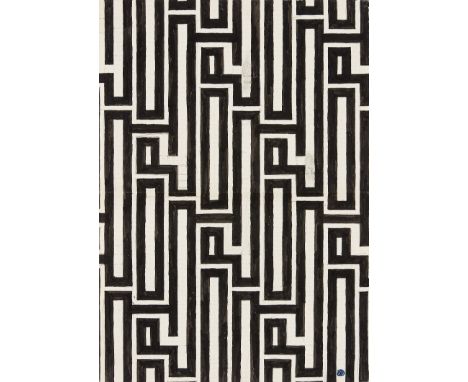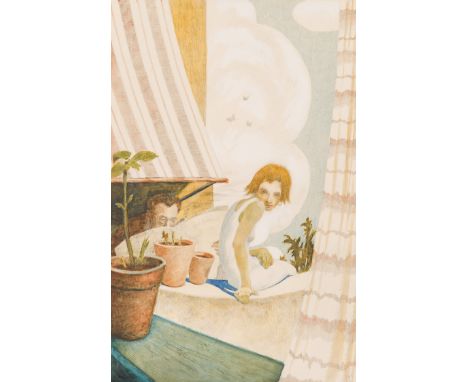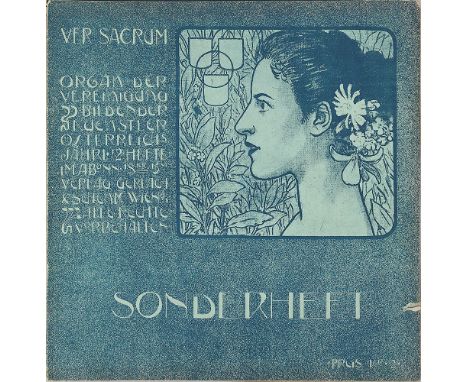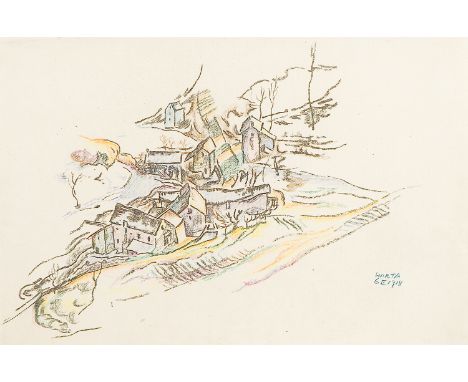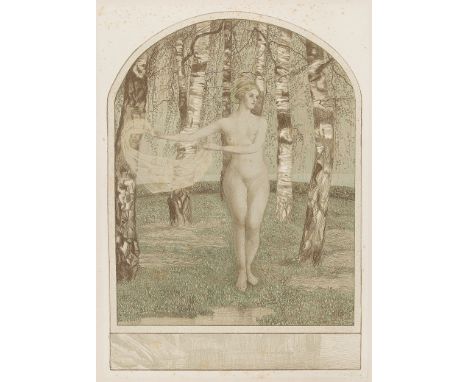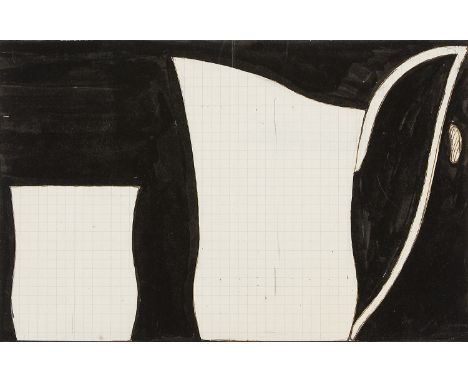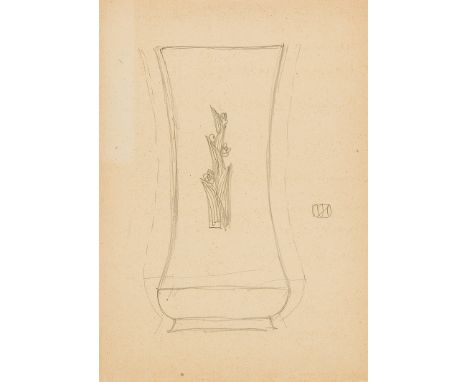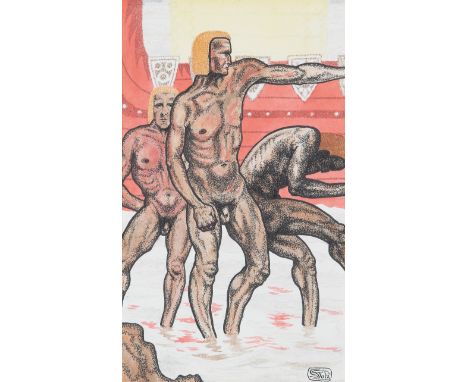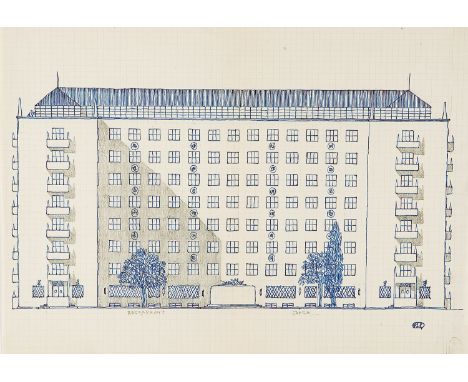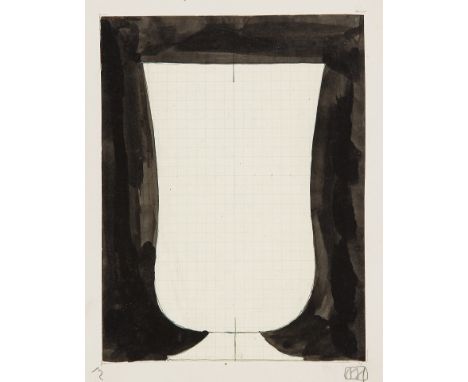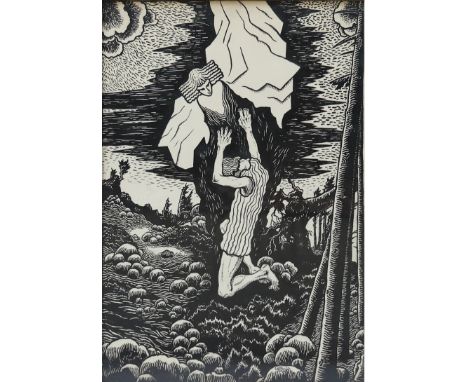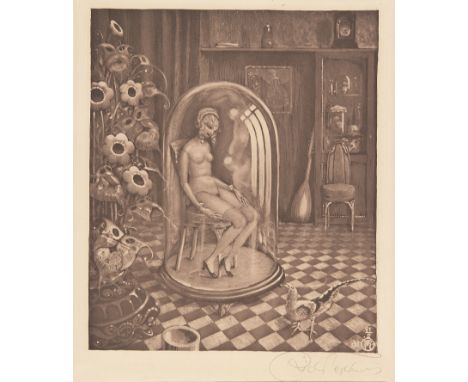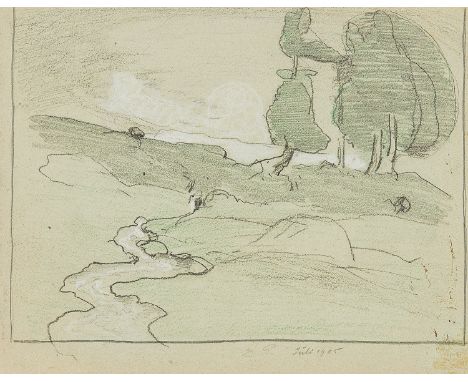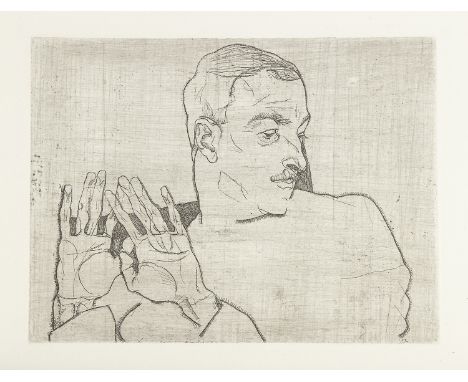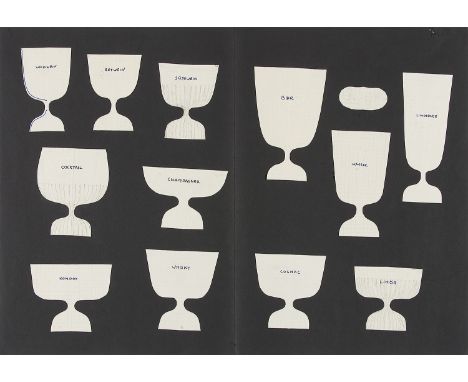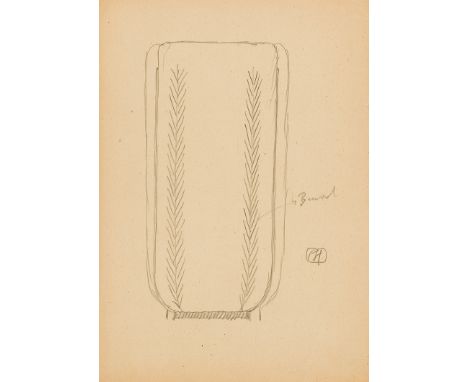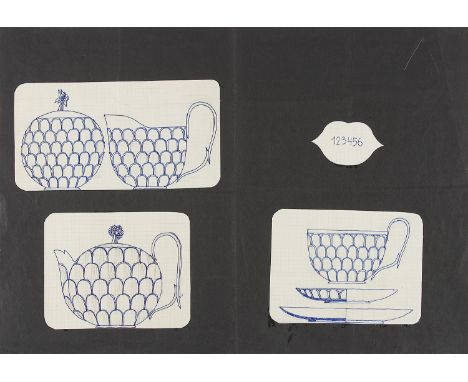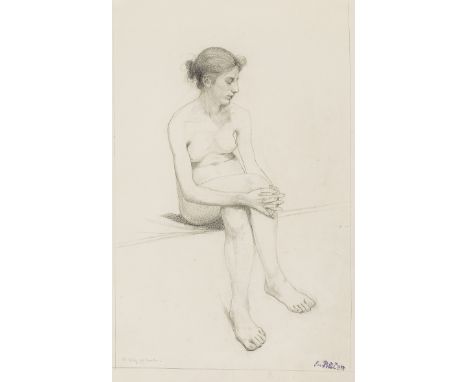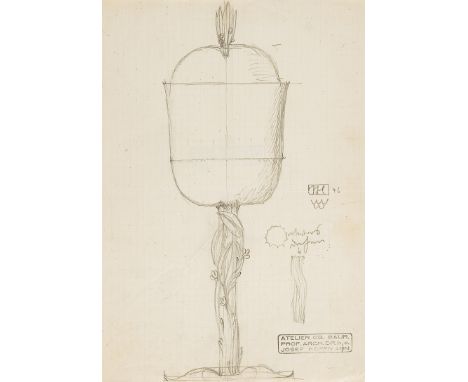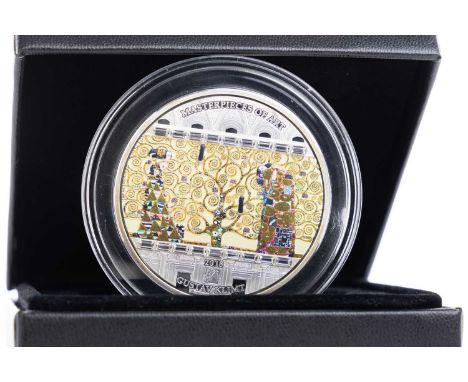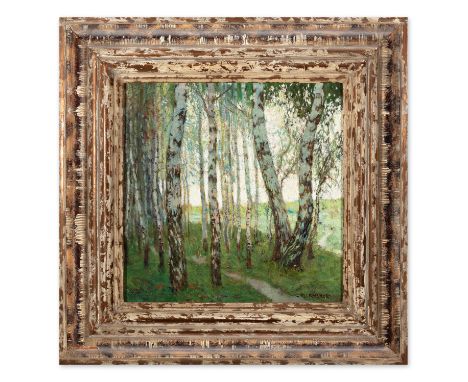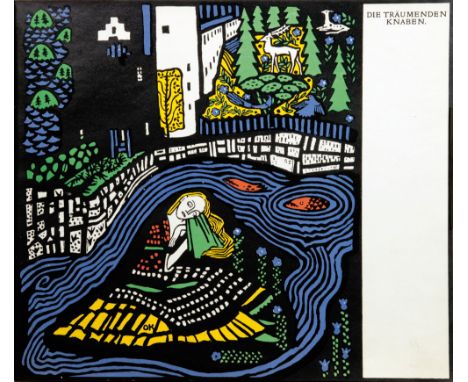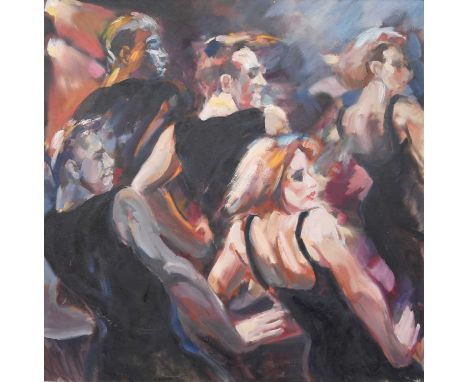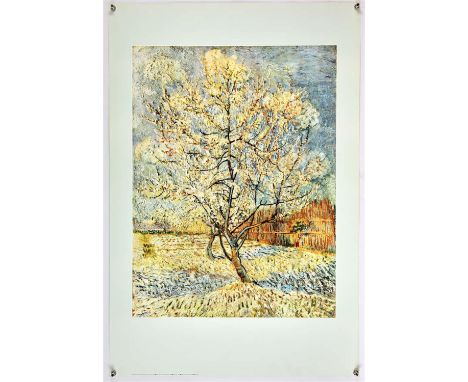Gustav KlimtStehender Akt von vorne (Studie im Zusammenhang mit "Die Freundinnen II")1915/16Bleistift auf Papier; gerahmt57 x 37,3 cmverso: unvollendete Skizzeehemals Galerie Manfred Strake, Düsseldorf;Galerie Welz, Salzburg;Kornfeld Galerie & Cie Bern, 20.06.1991, Nr. 523;Neumeister, München, 23.05.1992, Nr. 133;Kunsthaus Zacke, Wien;dort am 29.03.1995 erworben, seither österreichischer Privatbesitz1964 Salzburg, Galerie Welz, Gustav Klimt, Handzeichnungen, 05.08.-13.09., Nr. 82;1972 München, Arnoldi-Livie, Gustav Klimt, Nr. 6Alice Strobl, Gustav Klimt, Die Zeichnungen 1912-1918, Bd. III, Salzburg 1984, Nr. 2756, Abb. S. 163Das Motiv der stehenden weiblichen Aktfigur ist in Klimts Gemälden häufig anzutreffen und gelangt in seinen letzten Schaffensjahren zu einer besonderen Blüte. Als Zeichner wird Klimt nicht müde, die Körpermerkmale und die Temperamente seiner aufrecht stehenden Modelle festzuhalten, sei es in einem mehr oder weniger engen Zusammenhang mit seinen Gemälden, sei es in einem völlig eigenständigen Arbeitsvorgang.Alice Strobl ordnet die vorliegende Zeichnung den zahlreichen Blättern zu, die Klimt im Zusammenhang mit der frontalen Aktfigur im Gemälde "Die Freundinnen II" (1916/17, 1945 in Schloss Immendorf verbrannt) geschaffen hat. Sie reiht diese Studie in die frühe Phase der vorbereitenden Arbeiten für "Die Freundinnen II" ein, die ihren Recherchen zufolge schon ab 1915 zu datieren ist. In dieser frühen Gruppe seien "plastische Werte durchaus betont, was sowohl durch einen vollschlankeren Typus, gerundete Umrisse und Strichkonzentrierungen an bestimmten Stellen seinen Ausdruck findet" (Strobl, Bd. III, S. 155).In unserer Zeichnung führt die teils flüssige, teils mehrmals unterbrochene Linienführung zu einem lebhaften Pulsieren der Umrisse, die die unbearbeitete Hautpartie anders aufleuchten lassen als die gleichfalls leer gelassene Umgebung. Ein für Klimt charakteristisches Spannungselement bildet die Art, in der Kopf und Unterschenkel von den Blatträndern überschnitten werden. Trotz dieser Barrieren scheint die Figur sinnlich nah an uns heranzukommen.(Marian Bisanz-Prakken)
We found 1331 price guide item(s) matching your search
There are 1331 lots that match your search criteria. Subscribe now to get instant access to the full price guide service.
Click here to subscribe- List
- Grid
-
1331 item(s)/page
Michael PowolnyMädchen mit Rosen (nach links blickend)Wiener Keramik, um 1911Keramik aus hellem Scherben, weiß glasiert; rückseitig auf der Plinthe gemarkt mit Entwerfermonogramm "MP" und Firmenmarke der Wiener Keramik; an der Innenseite mit altem Verkaufsetikett der Wiener KeramikH. 29 cmArlt, Weilinger, Wiener Keramik, Werkverzeichnis. Wien 2018; S. 50 & 51; S. 316 WK-Modellnr. 269; Elisabeth Frottier, Michael Powolny. Keramik und Glas aus Wien. 1900 bis 1950. Monografie und Werkverzeichnis, Wien/Köln 1990, WV 114Unsere Pendants wurden 1911 von Michael Powolny entworfen und befanden sich seit dem Kauf gemeinsam im Besitz einer Familie. Gleichzeitig hergestellt sind sie jedoch nicht worden - das verrät ein leichter Unterschied im Weißton sowie die noch erhaltenen, verschiedenen Verkaufsetiketten auf den Innenseiten der Keramiken.Die Mädchen mit Rosen sind in ihrer eleganten Zurückhaltung beeindruckende Zeugnisse von Michael Powolnys Wandlungsfähigkeit und wurden - wie viele Keramiken der Wiener Keramik - in unterschiedlichen Farbvariationen hergestellt. Während Powolny meist sehr verspielte Figuren entwarf, treten hier besonders antike und architektonische Vorbilder in den Vordergrund. Die Figuren stehen auf hohen, würfeligen Sockeln betont aufrecht und erinnern an Karyatiden. Die weiße Ausführung vertieft diesen Eindruck. Durch die locker drapierte Rosengirlande und die Wellenlinie kombiniert er dazu typische Elemente des Secessionsstils, die im bewussten Gegensatz zu zeitgleichen Kunstwerken der Wiener Werkstätte stehen. Mit Frisuren und Gesichtern zieht Powolny Parallelen zu Gustav Klimts Frauendarstellungen in dieser Zeit. Diese Verbindung mag auch der Grund gewesen sein, dass gleiche Pendants Teil der Ausstattung des berühmten von Josef Hoffmann und der Wiener Werkstätte als Gesamtkunstwerk geplanten Palais Stoclet (erbaut 1905 bis 1911) wurden, in dem auch Gustav Klimt seinen Stoclet-Fries schuf. (ABS)
Rudolf von AltBrautpaar im Chor der Breitenfelder Pfarrkirche in Wien1899Aquarell auf Papier; gerahmt46 x 33 cm (Passep.-Ausschnitt)Signiert und datiert rechts unten: Rudolf v. Alt (1)899Bassenge Berlin, 3.12.2021, Nr. 6787;österreichischer PrivatbesitzErste Pläne für eine Gedächtniskirche zu Ehren von Kaiser Franz I. (1768-1835), gab es bereis in dessen Todesjahr 1835. Im damaligen Vorort Breitenfeld, einem kleinen Dorf, welches vor den Stadtmauern Wiens lag, und erst 1850 in den Bezirk Josefstadt eingemeindet wurde, sollte dieses Bauvorhaben realisiert werden. Die Errichtung der Kirche im Stile der Frührenaissance erfolgte jedoch erst ab 1894, die Weihe fand 1898 im Beisein von Kaiser Franz Joseph I. (1830-1916) statt. Rudolf von Alt lebte seit 1841 in der Skodagasse, unweit der neu errichteten Breitenfelder Pfarrkirche. Als interessierter Architekturmaler hat er deren Bau mit Sicherheit verfolgt. Der bereits 87-jährige Künstler malte vorliegendes Aquarell ein Jahr nach der Fertigstellung der Kirche, und zeigt einen Einblick in den Chor, den er mit einer kleinen Hochzeitsgesellschaft belebt. Sein fortgeschrittenes Alter ließ nun keine weiten Reisen mehr zu, und Themen aus seiner Heimatstadt Wien stehen wieder im Zentrum seines Schaffens. Der hochangesehene Alt hatte als Künstler viel erreicht und geleistet. Größte Wertschätzung wurde dem "Meister des Aquarells" nun auch von seinen jungen Künstlerkollegen rund um Gustav Klimt entgegengebracht, die ihn 1897 zum Ehrenpräsidenten der neu gegründeten Wiener Secession wählten. Das Kaiserhaus zollte ihm im gleichen Jahr Anerkennung, und er wurde als "Ritter von Alt" in den Adelsstand erhoben. Sein langes, überaus schöpferisches Leben endete 1905 in Wien. (MS)
Oskar Kokoschka (Pöchlarn 1886 - Montreux 1980). Tower Bridge II. 1967. Lithographie. 62 x 90 cm. R. u. mit Bleistift sign. O. Kokoschka, l. u. num. 72/75, unter Glas gerahmt, ungeöffnet. - Österreichischer Maler, Graphiker und Dichter des Expressionismus. K. studierte an der Wiener Kunstgewerbeschule u.a. bei G. Klimt, verwarf aber für sich den dekorativen Jugendstil seiner Zeit und entwickelte stattdessen eine stark subjektiv-gefühlsbetonte Bildsprache. Er war Mitglied der 'Freien Sezession' in Berlin. Zu seinen wichtigsten Ausstellungen gehörte die Teilnahme an der Documenta I bis III. Mus.: Basel, Stuttgart, Hamburg (Kunsthalle), Hannover (Sprengel Mus.), New York (MoMA), Prag, Köln u.a. Lit.: Thieme-Becker, Vollmer, Spielmann 'O.K. - Leben u. Werk', Wingler/Welz 'K. - Das druckgraph. Werk' u.a.
Amano, Yoshitaka -- Ohne TitelFeder in Schwarz (Sumi-e) auf faserigem handgeschöpften Reispapier. 2002.33,5 x 35 cm.Bedrohlich wirken die riesenhaften Augen der phantastischen Kreatur, die charakteristisch ist für Amanos ganz eigenes, skurriles Figurenrepertoire. Explosionsartig sprüht sie Linien, Rauchschwaden und kleine Spitter in den Raum, und ihre Wirkung scheint sich weit über die Bildfläche hinaus ausdehnen zu wollen. Bekanntheit erlangte Amano erstmals in den späten 1960er Jahren mit seiner Arbeit an der Anime-Adaption von Speed Racer, dann auch als Schöpfer kultiger und einflussreicher Charaktere wie Gatchaman, Tekkaman: The Space Knight, Hutch the Honeybee und Casshan. Er wandte sich der freien Kunst zu, studierte Klimt und Rackham ebenso wie antike Sagen. In seinen Sumi-e Zeichnungen mischen sich die Einflüsse von Manga und Anime, Züge seiner dunklen Kreaturen, wie dem Videospiel Final Fantasy entstiegen, mit der Kunst der Kalligraphie, Tradition und Moderne vereinen sich. "It is the force of imagination itself, the mind's eye that cannot explain but can expand beyond the universe, a realized potential Yoshitaka Amano describes as 'that instantaneous thrust of momentum that determines the end result'" (Carlo Mc Cormick, in: Yoshitaka Amano, leo-koenig.com, Zugriff 08.07.2024).Provenienz: Leo König, New York (mit dessen Klebeetikett auf der Rahmenrückseite, dort datiert und bezeichnet) - Wir bitten darum, Zustandsberichte zu den Losen zu erfragen, da der Erhaltungszustand nur in Ausnahmefällen im Katalog angegeben ist. - Please ask for condition reports for individual lots, as the condition is usually not mentioned in the catalogue.
Matsch, Franz Josef Karl von -- Entwurfsskizze für den "Brunnen des Lebens im Palais Dumba" in Wien.Gouache über Bleistift, auf dem orig. Untersatz. 49,4 x 37,8 cm. Am Unterrand signiert "F. vMatsch" sowie eigenh. bezeichnet "Meinem lieben Freund Pfr. Kautsch / Skizze des 'Brunnen des Lebens' im Palais Dumba". Franz von Matsch begann seine künstlerische Laufbahn an der renommierten Wiener Kunstgewerbeschule. Hier studierte er gemeinsam mit den Brüdern Gustav und Ernst Klimt unter der Leitung von Professoren wie Ferdinand Laufberger und Julius von Berger. Die Zusammenarbeit mit den Brüdern Klimt führte zur Gründung der "Maler-Compagnie", einer Künstlergemeinschaft, die mit großen öffentlichen Aufträgen betraut wurde. Die enge Zusammenarbeit dieser Künstlergruppe wurde 1892 durch den Tod von Ernst Klimt unterbrochen, was letztlich zur Auflösung der Gemeinschaft führte. In demselben Jahr trat Matsch dem Wiener Künstlerhaus bei, einer wichtigen Institution für zeitgenössische Künstler. Doch bereits 1898 vollzog er gemeinsam mit der sogenannten „Klimt-Gruppe“ den Austritt, ein Schritt, der auf die sich verschärfenden Spannungen zwischen traditioneller und moderner Kunstauffassung hinwies. Diese Ereignisse markieren den Übergang zur Wiener Secession, die von Gustav Klimt und anderen Progressiven vorangetrieben wurde - Matsch jedoch blieb der traditionelleren akademischen Richtung verbunden. Ab 1898 wandte sich Matsch auch der Bildhauerei zu, in deren Bereich auch der aufwendig inszenierte "Lebensbrunnen" fällt, wenngleich dieser auch nie ausgeführt wurde. Matsch verkörpert eine facettenreiche Künstlerpersönlichkeit, die sowohl die akademische Tradition als auch den Wandel zur Moderne erlebte, ohne jedoch selbst radikale Schritte in Richtung der Avantgarde zu machen. - Wir bitten darum, Zustandsberichte zu den Losen zu erfragen, da der Erhaltungszustand nur in Ausnahmefällen im Katalog angegeben ist. - Please ask for condition reports for individual lots, as the condition is usually not mentioned in the catalogue.
VERSCHIEDENE KÜNSTLERINNEN UND KÜNSTLER (Zweite Hälfte 19. Jhr. - erste Hälfte 20. Jhr.)Konvolut fünf Hefte Ver Sacrum jeweils 29,9 x 29 cm alle aus dem Jahr 1898 1. Heft: Ver Sacrum Sonderheft, Deckblatt fällt ab, Heft am Rücken geteilt 2. Heft: Ver Sacrum, 1. Jahrgang, 1. Heft, Januar 1898, Im Rücken geteilt, Deckblatt eingerissen am Rücken 3. Heft: Ver Sacrum, 1. Jahrgang, 7. Heft, Juli 1898. Deckblatt abgerissen, Heft in der Mitte geteilt 4. Heft: Ver Sacrum 1. Jahrgang, 9. Heft, September 1898. Deckblatt und Rückseite abgerissen, mehrmals am Rücken geteilt 5. Heft: Ver Sacrum, 1. Jahrgang, 10. Heft, Oktober 1898, Deckblatt und Rückseite abgerissen, mehrmals am Rücken geteiltSCHÄTZPREIS / ESTIMATE °€ 150 - 300STARTPREIS / STARTING PRICE °€ 150"Ver Sacrum" (lat.: Heiliger Frühling) war eine von der Wiener Secession herausgegebene Kunst- und Literaturzeitschrift, die 1898 bis 1903 in Wien erschien. Ver Sacrum war das offizielle Organ der Vereinigung bildender Künstler Österreichs. Das erste Heft (Januar 1898) enthielt Texte von Hermann Bahr, Alfred Roller und Max Burckhard. Das Umschlagmotiv stammte vom Hauptredakteur Alfred Roller: Die Wurzeln eines blühenden Bäumchens, das im Blattwerk drei unbedruckte Wappenschilde für die Bereiche Architektur, Malerei und Skulptur trägt, sprengen die Dauben eines zu eng gewordenen hölzernen Pflanzkübels und beginnen, im Erdreich zu wurzeln (siehe Cover rechts). Frühlingsstimmung vermitteln die tanzenden oder verträumten Frauengestalten, die blühenden Bäume und die florale Ornamentik von Koloman Moser, Josef Hoffmann, Joseph Maria Olbrich, Maximilian Lenz und anderen; ebenso Gustav Klimt, der sich kurze Zeit als Buchschmuck-Künstler betätigte. Adolf Hölzel veröffentlichte seinen programmatischen Aufsatz Über Formen und Massenverteilung im Jahr 1901 im 15. Heft. Einen bedeutenden Schritt zur Ungegenständlichkeit setzte auch Ernst Stöhr, der im letzten Ver-Sacrum-Heft von 1899 die symbolistische Komponente vertrat. Ab 1900 trat der Informationswert stärker in den Vordergrund. Ab dem dritten Jahrgang erschien die Zeitschrift zweimal anstatt einmal im Monat, jedoch in kleinerer Auflage. Mit der Ankündigung einer „zwanglosen Folge von Veröffentlichungen“ und einem Rückblick auf die sechsjährige Editionsgeschichte wurde die regelmäßige Veröffentlichung, nachdem sie „ihren Zweck erfüllt“ hatte, Ende 1903 eingestellt.Bitte beachten: Der Kaufpreis besteht aus Meistbot zuzüglich des Aufgeldes, der Umsatzsteuer sowie gegebenenfalls der Folgerechtsabgabe. Bei Normalbesteuerung (mit ° beim Schätzpreis gekennzeichnet) kommt auf das Meistbot ein Aufgeld in der Höhe von 24% hinzu. Auf die Summe von Meistbot und Aufgeld kommt die gesetzliche Umsatzsteuer hinzu. Diese beträgt 13% bei Gemälden, Aquarellen, Zeichnungen, Grafiken sowie Skulpturen und 20% bei Fotografien und allen anderen Objekten. Bei Differenzbesteuerung beträgt das Aufgeld 28%. Die Umsatzsteuer ist bei der Differenzbesteuerung inkludiert.
HERBERT BOECKL* (Klagenfurt 1894 - 1966 Wien)Beim Wörthersee, 1950Aquarell/Papier 37 x 50,8 cmsigniert Herbert Boeckl, datiert 1950verso beschriftet Herbert Boeckl 1950, Landschaft südlich des Wörthersees. Nachlaß B69. Bestätigt von Maria Boeckl 69BSCHÄTZPREIS / ESTIMATE € 4000 - 6000STARTPREIS / STARTING PRICE € 4000Herbert Boeckl war ein österreichischer Künstler. Nach der Matura in Klagenfurt ging er 1912 nach Wien, wo er sich an der Akademie der bildenen Künste bewarb. Als Böckl abgelehnt wurde, begann er an der Bauschule der Technischen Hochschule Architektur zu studieren und war Privatschüler von Adolf Loos. Durch Loos trat er in Kontakt mit Künstlern wie Egon Schiele, Gustav Klimt und Carl Moll und konnte seine Arbeiten zum ersten Mal 1913 in einer Gemeinschaftsausstellung des Österreichischen Künstlerbundes im Kunstsalon Pisko zeigen. Während des Ersten Weltkriegs diente Böckl an der italienischen Front im gleichen Regiment wie Bruno Grimschitz, ein Freund und Förderer von Boeckl sowie späterer Direktor der Österreichischen Galerie im Bevedere. Nach dem Krieg heiratete Böckl Maria Plahna, die ihm in den ersten Jahren der Ehe als Aktmodell diente. Nach der ersten Staatsprüfung an der Technischen Hochschule 1918 gab er sein Studium auf, bezog ein Atelier in Klagenfurt und beteiligte sich an einer Ausstellung des Kunstvereins Kärnten im Künstlerhaus. Egon Schiele war begeistert und empfahl Boeckl an den Wiener Kunsthändler und Verleger Gustav Nebehay. Ein Vertrag mit Nebehay sicherte Böckl wirtschaftlich ab und ermöglichte ihm Studienreisen nach Berlin, Paris und Sizilien. Die erste große Präsentation seiner Arbeiten findet im Rahmen der Herbstausstellung der Secession 1927 statt, wo 30 Ölgemälde gezeigt werden. 1935 erfolgte die Berufung als Professor an die Akademie der bildenden Künste, ab 1938 änderte der Künstler die Schreibweise seines Namens von Böckl auf Boeckl. Während des Zweiten Weltkriegs zog sich Boeckl zurück und überahm statt der Leitung der Meisterklasse den täglichen Abendakt. Nach dem Krieg wurde er Rektor. Bereits 1946 wurde er als Rektor wieder abberufen. Anfang der 1950er Jahre begann Boeckl, an dem monumentalen Fresko für die Engelskapelle im Stift Seckau zu arbeiten. Boeckl erhielt 1934 und 1953 den Großen Österreichischen Staatspreis, 1960 die Klimt-Ehrung der Secession und 1964 das Goldene Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst der Republik Österreich und den Ehrenring der Stadt Wien. 1964 fand eine große Boeckl-Retrospektive im Museum des 20. Jahrhunderts statt.Bitte beachten: Der Kaufpreis besteht aus Meistbot zuzüglich des Aufgeldes, der Umsatzsteuer sowie gegebenenfalls der Folgerechtsabgabe. Bei Normalbesteuerung (mit ° beim Schätzpreis gekennzeichnet) kommt auf das Meistbot ein Aufgeld in der Höhe von 24% hinzu. Auf die Summe von Meistbot und Aufgeld kommt die gesetzliche Umsatzsteuer hinzu. Diese beträgt 13% bei Gemälden, Aquarellen, Zeichnungen, Grafiken sowie Skulpturen und 20% bei Fotografien und allen anderen Objekten. Bei Differenzbesteuerung beträgt das Aufgeld 28%. Die Umsatzsteuer ist bei der Differenzbesteuerung inkludiert.
JOSEF HOFFMANN* (Pirnitz 1870 - 1956 Wien)Teetasse und Vase mit BlätterkranzTinte/Papier 20,7 x 29,5 cmverso Atelierstempel Josef Hoffmann und beschriftet Kauf Gal. Würthle am 2.9.81 S 3500,-SCHÄTZPREIS / ESTIMATE °€ 250 - 500STARTPREIS / STARTING PRICE °€ 250Josef Hoffmann, Schüler von Otto Wagner, war als Architekt und Gestalter eine der zentralen Figuren der Wiener Moderne. 1903 gründete er mit Koloman Moser und dem Industrielle Fritz Waerndorfer die Wiener Werkstätte (WW), nach dem Vorbild der britischen Arts and Crafts Movement und unter dem Eindruck des Wiener Jugendstils. Hoffmann, befreundet u. a. mit Gustav Klimt und Anton Hanak, blieb bis zum Konkurs 1932 einer der wichtigsten Gestalter der WW. Die Wiener Werkstätte, bezeichnet auch als Wiener Werkstatt, Vienna Workshop, Wiener Werkstaetten oder Wiener Werkstätten, hatte die Zielsetzung, die gesamten Lebensbereiche des Menschen gestalterisch zu vereinen, im Sinne eines Gesamtkunstwerks. Zu den Kunden zählten hauptsächlich Künstler und die aufstrebende jüdische Ober- und Mittelschicht. Die Bekanntschaft Josef Hoffmanns mit Berta Zuckerkandl führte zum ersten großen Auftrag: dem Sanatorium Purkersdorf, von Viktor Zuckerkandl, Bertas Schwager, westlich von Wien geplant. Unter den Mitarbeitern der WW war auch rund ein Dutzend Frauen, die entscheidend für den Stilwandel vom Jugendstil zum Art Déco der 20er-Jahre waren, z. B. Vally Wieselthier, Gudrun Baudisch, Reni Schaschl, Hilda Jesser und Susi Singer. Die NS-Zeit überstand Josef Hoffmann trotz Anfeindungen des NS-Architekturideologen Paul Schmitthenner unbeschadet. Von der Reichskammer der bildenden Künste wurde er beauftragt, als künstlerischer Leiter den Wiener Kunsthandwerksverein (eine NS-Nachfolgeorganisation des Österreichischen Werkbundes) weiterzuentwickeln. Zu diesem Zweck wurde 1941 eine „künstlerische Versuchsanstalt“ gegründet, in der junge Kunsthandwerker sich unter Hoffmanns Anleitung weiterbilden konnten. Nach dem Krieg, 1948, gründete Hoffmann die Österreichischen Werkstätten als Nachfolgerin von Wiener Werkstätte und Werkbund (ÖWB), dem er bis 1920 angehört hatte. Hoffmanns Grabstein wurde von Fritz Wotruba gestaltet.Bitte beachten: Der Kaufpreis besteht aus Meistbot zuzüglich des Aufgeldes, der Umsatzsteuer sowie gegebenenfalls der Folgerechtsabgabe. Bei Normalbesteuerung (mit ° beim Schätzpreis gekennzeichnet) kommt auf das Meistbot ein Aufgeld in der Höhe von 24% hinzu. Auf die Summe von Meistbot und Aufgeld kommt die gesetzliche Umsatzsteuer hinzu. Diese beträgt 13% bei Gemälden, Aquarellen, Zeichnungen, Grafiken sowie Skulpturen und 20% bei Fotografien und allen anderen Objekten. Bei Differenzbesteuerung beträgt das Aufgeld 28%. Die Umsatzsteuer ist bei der Differenzbesteuerung inkludiert.
EMILIE MEDIZ-PELIKAN (Vöcklabruck 1861 - 1908 Dresden)BirkenwaldLithografie, handkoloriert/Papier 49,5 x 57,8 cmRandfehlstellenSCHÄTZPREIS / ESTIMATE °€ 400 - 800STARTPREIS / STARTING PRICE °€ 400Österreichische Landschaftsmalerin. Hielt sich in der Künstlerkolonie Dachau und der Künstlerkolonie Knokke auf, stellte in der Wiener Secession und im Hagenbund aus. War verheiratet mit Karl Mediz. Die Küstlerin Gertrude Hnzatko-Mediz war eine Tochter des Paares. Stilistisch ist Mediz-Pelikan einzuordnen zwischen Jugendstil, Symbolismus, Stimmungsimpressionismus und Impressionismus. Schuf Zeichnungen und Druckgrafik mit Landschaften wie die Birken von Gustav Klimt. Gehört zu den bedeutenden österreichischen Künstlerinnen wie Tina Blau, Olga Wisinger-Florian und Marie Egner. Im Gesamtœuvre der in Vöcklabruck gebürtigen Künstlerin Emilie Mediz-Pelikan, nehmen Landschaften eine zentrale Stellung ein. Sie wurde mit 21 die letzte Privatschülerin des bereits hochbetagten Landschaftsmalers Albert Zimmermann. Mediz-Pelikan studierte an der Wiener Akademie und folgte Albert Zimmermann nach Salzburg und München. 1891 heiratete sie den Maler und Grafiker Karl Mediz, mit dem sie zuerst in Wien und ab 1894 in Dresden lebte. Sie stand in Kontakt zur Dachauer Künstlerkolonie und unternahm Studienreisen nach Paris, Belgien, Ungarn und Italien. Erst um 1900 gelang ihr mit ihren Landschaftsbildern der künstlerische Durchbruch. Da der Nachlass der 1908 in Dresden frühzeitig verstorbenen Künstlerin bis in die 1980er Jahre in der DDR gelagert war, kam es erst relativ spät zur Neuentdeckung und Wiederbewertung der Künstlerin, sowohl in der österreichischen Kunstgeschichte als auch am Kunstmarkt. 1986 kam es zu ersten großen Ausstellungen im Oberösterreichischen Landesmuseum und in der Hochschule für angewandte Kunst in Wien. Wie viele impressionistische Malerinnen setzte sich Emilie Mediz-Pelikan von Beginn ihrer künstlerischen Tätigkeit an intensiv mit der Natur und deren Veränderlichkeit auseinander. Oft sind ihre Werke in eine entrückte Atmosphäre eingetaucht. Das von ihr – und von ihrem Mann – oft verwendete Motiv der Birken findet sich später auch in Darstellungen bei Klimt, Baar oder Junk wieder. In einem Brief an ihren Mann aus dem Jahr 1893 beschreibt sie ihre Reise ins böhmische Chotěboř sowie die Schönheit der Bäume in dieser Gegend. Beim Durchblättern der Korrespondenz zwischen dem Ehepaar wird die zentrale Bedeutung der Natur sofort spürbar. Ausführlich sind die Beschreibungen der Landschaft und ihrer Vegetation, die Mediz-Pelikan auch detailreich in Skizzen festhielt. Eindrucksvolle Arbeiten entstanden auch bei Reisen ans Adriatische Meer, an Küstenorten wie Duino oder Dubrovnik (Lacroma).Bitte beachten: Der Kaufpreis besteht aus Meistbot zuzüglich des Aufgeldes, der Umsatzsteuer sowie gegebenenfalls der Folgerechtsabgabe. Bei Normalbesteuerung (mit ° beim Schätzpreis gekennzeichnet) kommt auf das Meistbot ein Aufgeld in der Höhe von 24% hinzu. Auf die Summe von Meistbot und Aufgeld kommt die gesetzliche Umsatzsteuer hinzu. Diese beträgt 13% bei Gemälden, Aquarellen, Zeichnungen, Grafiken sowie Skulpturen und 20% bei Fotografien und allen anderen Objekten. Bei Differenzbesteuerung beträgt das Aufgeld 28%. Die Umsatzsteuer ist bei der Differenzbesteuerung inkludiert.
JOSEF HOFFMANN* (Pirnitz 1870 - 1956 Wien)Entwurf für eine WandlampeBleistift/Papier 42 x 29,7 cmverso Atelierstempel Josef HoffmannSCHÄTZPREIS / ESTIMATE °€ 300 - 600STARTPREIS / STARTING PRICE °€ 300Josef Hoffmann, Schüler von Otto Wagner, war als Architekt und Gestalter eine der zentralen Figuren der Wiener Moderne. 1903 gründete er mit Koloman Moser und dem Industrielle Fritz Waerndorfer die Wiener Werkstätte (WW), nach dem Vorbild der britischen Arts and Crafts Movement und unter dem Eindruck des Wiener Jugendstils. Hoffmann, befreundet u. a. mit Gustav Klimt und Anton Hanak, blieb bis zum Konkurs 1932 einer der wichtigsten Gestalter der WW. Die Wiener Werkstätte, bezeichnet auch als Wiener Werkstatt, Vienna Workshop, Wiener Werkstaetten oder Wiener Werkstätten, hatte die Zielsetzung, die gesamten Lebensbereiche des Menschen gestalterisch zu vereinen, im Sinne eines Gesamtkunstwerks. Zu den Kunden zählten hauptsächlich Künstler und die aufstrebende jüdische Ober- und Mittelschicht. Die Bekanntschaft Josef Hoffmanns mit Berta Zuckerkandl führte zum ersten großen Auftrag: dem Sanatorium Purkersdorf, von Viktor Zuckerkandl, Bertas Schwager, westlich von Wien geplant. Unter den Mitarbeitern der WW war auch rund ein Dutzend Frauen, die entscheidend für den Stilwandel vom Jugendstil zum Art Déco der 20er-Jahre waren, z. B. Vally Wieselthier, Gudrun Baudisch, Reni Schaschl, Hilda Jesser und Susi Singer. Die NS-Zeit überstand Josef Hoffmann trotz Anfeindungen des NS-Architekturideologen Paul Schmitthenner unbeschadet. Von der Reichskammer der bildenden Künste wurde er beauftragt, als künstlerischer Leiter den Wiener Kunsthandwerksverein (eine NS-Nachfolgeorganisation des Österreichischen Werkbundes) weiterzuentwickeln. Zu diesem Zweck wurde 1941 eine „künstlerische Versuchsanstalt“ gegründet, in der junge Kunsthandwerker sich unter Hoffmanns Anleitung weiterbilden konnten. Nach dem Krieg, 1948, gründete Hoffmann die Österreichischen Werkstätten als Nachfolgerin von Wiener Werkstätte und Werkbund (ÖWB), dem er bis 1920 angehört hatte. Hoffmanns Grabstein wurde von Fritz Wotruba gestaltet.Bitte beachten: Der Kaufpreis besteht aus Meistbot zuzüglich des Aufgeldes, der Umsatzsteuer sowie gegebenenfalls der Folgerechtsabgabe. Bei Normalbesteuerung (mit ° beim Schätzpreis gekennzeichnet) kommt auf das Meistbot ein Aufgeld in der Höhe von 24% hinzu. Auf die Summe von Meistbot und Aufgeld kommt die gesetzliche Umsatzsteuer hinzu. Diese beträgt 13% bei Gemälden, Aquarellen, Zeichnungen, Grafiken sowie Skulpturen und 20% bei Fotografien und allen anderen Objekten. Bei Differenzbesteuerung beträgt das Aufgeld 28%. Die Umsatzsteuer ist bei der Differenzbesteuerung inkludiert.
JOSEF HOFFMANN* (Pirnitz 1870 - 1956 Wien)PokalentwurfBleistift und Tusche/Papier 25 x 15,5 cmsigniert Hoffmann, monogrammiert JHbeschriftet Glas, 112, 47, verso Atelierstempel Josef Hoffmann und beschriftet N. 28montiert auf KartonSCHÄTZPREIS / ESTIMATE °€ 400 - 800STARTPREIS / STARTING PRICE °€ 400Josef Hoffmann, Schüler von Otto Wagner, war als Architekt und Gestalter eine der zentralen Figuren der Wiener Moderne. 1903 gründete er mit Koloman Moser und dem Industrielle Fritz Waerndorfer die Wiener Werkstätte (WW), nach dem Vorbild der britischen Arts and Crafts Movement und unter dem Eindruck des Wiener Jugendstils. Hoffmann, befreundet u. a. mit Gustav Klimt und Anton Hanak, blieb bis zum Konkurs 1932 einer der wichtigsten Gestalter der WW. Die Wiener Werkstätte, bezeichnet auch als Wiener Werkstatt, Vienna Workshop, Wiener Werkstaetten oder Wiener Werkstätten, hatte die Zielsetzung, die gesamten Lebensbereiche des Menschen gestalterisch zu vereinen, im Sinne eines Gesamtkunstwerks. Zu den Kunden zählten hauptsächlich Künstler und die aufstrebende jüdische Ober- und Mittelschicht. Die Bekanntschaft Josef Hoffmanns mit Berta Zuckerkandl führte zum ersten großen Auftrag: dem Sanatorium Purkersdorf, von Viktor Zuckerkandl, Bertas Schwager, westlich von Wien geplant. Unter den Mitarbeitern der WW war auch rund ein Dutzend Frauen, die entscheidend für den Stilwandel vom Jugendstil zum Art Déco der 20er-Jahre waren, z. B. Vally Wieselthier, Gudrun Baudisch, Reni Schaschl, Hilda Jesser und Susi Singer. Die NS-Zeit überstand Josef Hoffmann trotz Anfeindungen des NS-Architekturideologen Paul Schmitthenner unbeschadet. Von der Reichskammer der bildenden Künste wurde er beauftragt, als künstlerischer Leiter den Wiener Kunsthandwerksverein (eine NS-Nachfolgeorganisation des Österreichischen Werkbundes) weiterzuentwickeln. Zu diesem Zweck wurde 1941 eine „künstlerische Versuchsanstalt“ gegründet, in der junge Kunsthandwerker sich unter Hoffmanns Anleitung weiterbilden konnten. Nach dem Krieg, 1948, gründete Hoffmann die Österreichischen Werkstätten als Nachfolgerin von Wiener Werkstätte und Werkbund (ÖWB), dem er bis 1920 angehört hatte. Hoffmanns Grabstein wurde von Fritz Wotruba gestaltet.Bitte beachten: Der Kaufpreis besteht aus Meistbot zuzüglich des Aufgeldes, der Umsatzsteuer sowie gegebenenfalls der Folgerechtsabgabe. Bei Normalbesteuerung (mit ° beim Schätzpreis gekennzeichnet) kommt auf das Meistbot ein Aufgeld in der Höhe von 24% hinzu. Auf die Summe von Meistbot und Aufgeld kommt die gesetzliche Umsatzsteuer hinzu. Diese beträgt 13% bei Gemälden, Aquarellen, Zeichnungen, Grafiken sowie Skulpturen und 20% bei Fotografien und allen anderen Objekten. Bei Differenzbesteuerung beträgt das Aufgeld 28%. Die Umsatzsteuer ist bei der Differenzbesteuerung inkludiert.
ARNOLD NECHANSKY (Wien 1888 - 1938 Kitzbühel)Feine DameTempera/Karton 5,3 x 5,7 cmmonogrammiert ANSCHÄTZPREIS / ESTIMATE °€ 400 - 800STARTPREIS / STARTING PRICE °€ 400Der Kunstgewerbler Arnold Nechansky war ein bedeutender Vertreter des Jugendstils. 1909 bis 1913 studierte er an der Wiener Kunstgewerbeschule bei Oskar Strnad, Adolf Böhm und Josef Hoffmann. Schon 1914 gestaltete er den österreichischen Pavillon auf der Kölner Werkbund Ausstellung. Ab 1917 entwarf er Keramiken für die von Hoffmann gegründete Wiener Werkstätte. 1919 erhielt Nechansky einen Ruf an die Kunstgewerbe- und Handelsschule in Charlottenburg, wo er fortan die Klasse für Metall- und Lederbearbeitung sowie die Vorbereitungsklasse für allgemeine Formbildung leitete. An seinem neuen Berliner Wirkungsort heiratete er 1923 die Wiener Malerin Marianne von Winter. 1934 kehrte Nechansky in seine Heimatstadt Wien zurück. Dort wirkte er bis zu seinem frühen Lebensende als Gestalter für Silber, Möbel, Stoffe und Porzellane im Auftrag der Firma Lobmeyr und der Wiener Werkstätte. Sein Können im Bereich Dekoration und Gestaltung kommt auch in den beiden hier abgebildeten kleinformatigen Werken zum Ausdruck. Der Betrachter ist ganz nah an die beiden Damen herangerückt, ihre Köpfe thronen auf den kunstvoll drapierten Gewandteilen. Auffallend sind die grazilen Hände, die einmal eine rote Perlenkette präsentieren oder sich wie in einer Tanzbewegung drehen. Das erinnert an die Tänzerinnen und Frauenbildnisse der Secessionskünstler, die wesentlich von Grete Wiesenthal und dem modernen Ausdruckstanz inspiriert wurden. Auch der geneigte Kopf, die blasse Haut und der blasierte Blick ergänzen diesen Eindruck. Die beiden fast quadratischen Bildnisse stellen keine Porträts bestimmter Damen dar, sondern „porträtieren“ vielmehr einen ganz bestimmten Frauentypus. Im Wesentlichen sind es die empfindsamen und schöngeistigen Wesen, wie sie auch in den Werken von Gustav Klimt und Egon Schiele zu finden sind. Bei Nechansky tritt der psychologisierende Aspekt freilich in den Hintergrund, stattdessen wird der dekorative Charakter betont. Dabei zeigen diese beiden Kleinodien deutliche Parallelen zu den Entwürfen für die Wiener Werkstätte aus der Hand des Künstlers. Der Frauentypus, die geneigte Kopfhaltung, die manierierte Position der Hände und die Art der Kleidung tauchen auch in seinen Postkarten, Stoffen, Keramiken, Schmuckstücken und Objekten auf. Die hier dargestellten Arbeiten wirken ebenfalls wie Versatzstücke und könnten durchaus in Zusammenhang mit Keramiken oder Schmuck entstanden sein. Bemerkenswert sind auch Farbigkeit und Oberfläche der Malerei, die an das zarte Erscheinungsbild von keramischen Kunstwerken erinnern und den fragilen und spielerischen Gesamteindruck betonen.Bitte beachten: Der Kaufpreis besteht aus Meistbot zuzüglich des Aufgeldes, der Umsatzsteuer sowie gegebenenfalls der Folgerechtsabgabe. Bei Normalbesteuerung (mit ° beim Schätzpreis gekennzeichnet) kommt auf das Meistbot ein Aufgeld in der Höhe von 24% hinzu. Auf die Summe von Meistbot und Aufgeld kommt die gesetzliche Umsatzsteuer hinzu. Diese beträgt 13% bei Gemälden, Aquarellen, Zeichnungen, Grafiken sowie Skulpturen und 20% bei Fotografien und allen anderen Objekten. Bei Differenzbesteuerung beträgt das Aufgeld 28%. Die Umsatzsteuer ist bei der Differenzbesteuerung inkludiert.
JOSEF HOFFMANN* (Pirnitz 1870 - 1956 Wien)Entwurf für eine TischlampeBleistift/Papier 42 x 29,7 cmbeschriftet 6-8 Lampenverso Atelierstempel Josef HoffmannSCHÄTZPREIS / ESTIMATE °€ 300 - 600STARTPREIS / STARTING PRICE °€ 300Josef Hoffmann, Schüler von Otto Wagner, war als Architekt und Gestalter eine der zentralen Figuren der Wiener Moderne. 1903 gründete er mit Koloman Moser und dem Industrielle Fritz Waerndorfer die Wiener Werkstätte (WW), nach dem Vorbild der britischen Arts and Crafts Movement und unter dem Eindruck des Wiener Jugendstils. Hoffmann, befreundet u. a. mit Gustav Klimt und Anton Hanak, blieb bis zum Konkurs 1932 einer der wichtigsten Gestalter der WW. Die Wiener Werkstätte, bezeichnet auch als Wiener Werkstatt, Vienna Workshop, Wiener Werkstaetten oder Wiener Werkstätten, hatte die Zielsetzung, die gesamten Lebensbereiche des Menschen gestalterisch zu vereinen, im Sinne eines Gesamtkunstwerks. Zu den Kunden zählten hauptsächlich Künstler und die aufstrebende jüdische Ober- und Mittelschicht. Die Bekanntschaft Josef Hoffmanns mit Berta Zuckerkandl führte zum ersten großen Auftrag: dem Sanatorium Purkersdorf, von Viktor Zuckerkandl, Bertas Schwager, westlich von Wien geplant. Unter den Mitarbeitern der WW war auch rund ein Dutzend Frauen, die entscheidend für den Stilwandel vom Jugendstil zum Art Déco der 20er-Jahre waren, z. B. Vally Wieselthier, Gudrun Baudisch, Reni Schaschl, Hilda Jesser und Susi Singer. Die NS-Zeit überstand Josef Hoffmann trotz Anfeindungen des NS-Architekturideologen Paul Schmitthenner unbeschadet. Von der Reichskammer der bildenden Künste wurde er beauftragt, als künstlerischer Leiter den Wiener Kunsthandwerksverein (eine NS-Nachfolgeorganisation des Österreichischen Werkbundes) weiterzuentwickeln. Zu diesem Zweck wurde 1941 eine „künstlerische Versuchsanstalt“ gegründet, in der junge Kunsthandwerker sich unter Hoffmanns Anleitung weiterbilden konnten. Nach dem Krieg, 1948, gründete Hoffmann die Österreichischen Werkstätten als Nachfolgerin von Wiener Werkstätte und Werkbund (ÖWB), dem er bis 1920 angehört hatte. Hoffmanns Grabstein wurde von Fritz Wotruba gestaltet.Bitte beachten: Der Kaufpreis besteht aus Meistbot zuzüglich des Aufgeldes, der Umsatzsteuer sowie gegebenenfalls der Folgerechtsabgabe. Bei Normalbesteuerung (mit ° beim Schätzpreis gekennzeichnet) kommt auf das Meistbot ein Aufgeld in der Höhe von 24% hinzu. Auf die Summe von Meistbot und Aufgeld kommt die gesetzliche Umsatzsteuer hinzu. Diese beträgt 13% bei Gemälden, Aquarellen, Zeichnungen, Grafiken sowie Skulpturen und 20% bei Fotografien und allen anderen Objekten. Bei Differenzbesteuerung beträgt das Aufgeld 28%. Die Umsatzsteuer ist bei der Differenzbesteuerung inkludiert.
ARNOLD NECHANSKY (Wien 1888 - 1938 Kitzbühel)Dame mit PerlenketteTempera/Karton 5,3 x 5,7 cmSCHÄTZPREIS / ESTIMATE °€ 400 - 800STARTPREIS / STARTING PRICE °€ 400Der Kunstgewerbler Arnold Nechansky war ein bedeutender Vertreter des Jugendstils. 1909 bis 1913 studierte er an der Wiener Kunstgewerbeschule bei Oskar Strnad, Adolf Böhm und Josef Hoffmann. Schon 1914 gestaltete er den österreichischen Pavillon auf der Kölner Werkbund Ausstellung. Ab 1917 entwarf er Keramiken für die von Hoffmann gegründete Wiener Werkstätte. 1919 erhielt Nechansky einen Ruf an die Kunstgewerbe- und Handelsschule in Charlottenburg, wo er fortan die Klasse für Metall- und Lederbearbeitung sowie die Vorbereitungsklasse für allgemeine Formbildung leitete. An seinem neuen Berliner Wirkungsort heiratete er 1923 die Wiener Malerin Marianne von Winter. 1934 kehrte Nechansky in seine Heimatstadt Wien zurück. Dort wirkte er bis zu seinem frühen Lebensende als Gestalter für Silber, Möbel, Stoffe und Porzellane im Auftrag der Firma Lobmeyr und der Wiener Werkstätte. Sein Können im Bereich Dekoration und Gestaltung kommt auch in den beiden hier abgebildeten kleinformatigen Werken zum Ausdruck. Der Betrachter ist ganz nah an die beiden Damen herangerückt, ihre Köpfe thronen auf den kunstvoll drapierten Gewandteilen. Auffallend sind die grazilen Hände, die einmal eine rote Perlenkette präsentieren oder sich wie in einer Tanzbewegung drehen. Das erinnert an die Tänzerinnen und Frauenbildnisse der Secessionskünstler, die wesentlich von Grete Wiesenthal und dem modernen Ausdruckstanz inspiriert wurden. Auch der geneigte Kopf, die blasse Haut und der blasierte Blick ergänzen diesen Eindruck. Die beiden fast quadratischen Bildnisse stellen keine Porträts bestimmter Damen dar, sondern „porträtieren“ vielmehr einen ganz bestimmten Frauentypus. Im Wesentlichen sind es die empfindsamen und schöngeistigen Wesen, wie sie auch in den Werken von Gustav Klimt und Egon Schiele zu finden sind. Bei Nechansky tritt der psychologisierende Aspekt freilich in den Hintergrund, stattdessen wird der dekorative Charakter betont. Dabei zeigen diese beiden Kleinodien deutliche Parallelen zu den Entwürfen für die Wiener Werkstätte aus der Hand des Künstlers. Der Frauentypus, die geneigte Kopfhaltung, die manierierte Position der Hände und die Art der Kleidung tauchen auch in seinen Postkarten, Stoffen, Keramiken, Schmuckstücken und Objekten auf. Die hier dargestellten Arbeiten wirken ebenfalls wie Versatzstücke und könnten durchaus in Zusammenhang mit Keramiken oder Schmuck entstanden sein. Bemerkenswert sind auch Farbigkeit und Oberfläche der Malerei, die an das zarte Erscheinungsbild von keramischen Kunstwerken erinnern und den fragilen und spielerischen Gesamteindruck betonen.Bitte beachten: Der Kaufpreis besteht aus Meistbot zuzüglich des Aufgeldes, der Umsatzsteuer sowie gegebenenfalls der Folgerechtsabgabe. Bei Normalbesteuerung (mit ° beim Schätzpreis gekennzeichnet) kommt auf das Meistbot ein Aufgeld in der Höhe von 24% hinzu. Auf die Summe von Meistbot und Aufgeld kommt die gesetzliche Umsatzsteuer hinzu. Diese beträgt 13% bei Gemälden, Aquarellen, Zeichnungen, Grafiken sowie Skulpturen und 20% bei Fotografien und allen anderen Objekten. Bei Differenzbesteuerung beträgt das Aufgeld 28%. Die Umsatzsteuer ist bei der Differenzbesteuerung inkludiert.
JOSEF HOFFMANN* (Pirnitz 1870 - 1956 Wien)Entwurf für Ruhmeshalle und Gruft, 1935Tusche/Papier 21 x 34 cmmonogrammiert JHbeschriftet 1:100vgl. Ausstellungskatalog Josef Hoffmann 1870-1956. Fortschritt durch Schönheit, MAK, Wien 2021, S. 355, Abb. 17, Projektvariante für eine Ruhmeshalle und Gruft österreichischer Musiker im Wiener Volksgarten, 1935SCHÄTZPREIS / ESTIMATE °€ 800 - 1600STARTPREIS / STARTING PRICE °€ 800Josef Hoffmann, Schüler von Otto Wagner, war als Architekt und Gestalter eine der zentralen Figuren der Wiener Moderne. 1903 gründete er mit Koloman Moser und dem Industrielle Fritz Waerndorfer die Wiener Werkstätte (WW), nach dem Vorbild der britischen Arts and Crafts Movement und unter dem Eindruck des Wiener Jugendstils. Hoffmann, befreundet u. a. mit Gustav Klimt und Anton Hanak, blieb bis zum Konkurs 1932 einer der wichtigsten Gestalter der WW. Die Wiener Werkstätte, bezeichnet auch als Wiener Werkstatt, Vienna Workshop, Wiener Werkstaetten oder Wiener Werkstätten, hatte die Zielsetzung, die gesamten Lebensbereiche des Menschen gestalterisch zu vereinen, im Sinne eines Gesamtkunstwerks. Zu den Kunden zählten hauptsächlich Künstler und die aufstrebende jüdische Ober- und Mittelschicht. Die Bekanntschaft Josef Hoffmanns mit Berta Zuckerkandl führte zum ersten großen Auftrag: dem Sanatorium Purkersdorf, von Viktor Zuckerkandl, Bertas Schwager, westlich von Wien geplant. Unter den Mitarbeitern der WW war auch rund ein Dutzend Frauen, die entscheidend für den Stilwandel vom Jugendstil zum Art Déco der 20er-Jahre waren, z. B. Vally Wieselthier, Gudrun Baudisch, Reni Schaschl, Hilda Jesser und Susi Singer. Die NS-Zeit überstand Josef Hoffmann trotz Anfeindungen des NS-Architekturideologen Paul Schmitthenner unbeschadet. Von der Reichskammer der bildenden Künste wurde er beauftragt, als künstlerischer Leiter den Wiener Kunsthandwerksverein (eine NS-Nachfolgeorganisation des Österreichischen Werkbundes) weiterzuentwickeln. Zu diesem Zweck wurde 1941 eine „künstlerische Versuchsanstalt“ gegründet, in der junge Kunsthandwerker sich unter Hoffmanns Anleitung weiterbilden konnten. Nach dem Krieg, 1948, gründete Hoffmann die Österreichischen Werkstätten als Nachfolgerin von Wiener Werkstätte und Werkbund (ÖWB), dem er bis 1920 angehört hatte. Hoffmanns Grabstein wurde von Fritz Wotruba gestaltet.Bitte beachten: Der Kaufpreis besteht aus Meistbot zuzüglich des Aufgeldes, der Umsatzsteuer sowie gegebenenfalls der Folgerechtsabgabe. Bei Normalbesteuerung (mit ° beim Schätzpreis gekennzeichnet) kommt auf das Meistbot ein Aufgeld in der Höhe von 24% hinzu. Auf die Summe von Meistbot und Aufgeld kommt die gesetzliche Umsatzsteuer hinzu. Diese beträgt 13% bei Gemälden, Aquarellen, Zeichnungen, Grafiken sowie Skulpturen und 20% bei Fotografien und allen anderen Objekten. Bei Differenzbesteuerung beträgt das Aufgeld 28%. Die Umsatzsteuer ist bei der Differenzbesteuerung inkludiert.
JOSEF HOFFMANN* (Pirnitz 1870 - 1956 Wien)VasenentwurfBleistift/Papier 42,3 x 29,5 cmmonogrammiert JHgestempelt Prof. Josef Hoffmann Wien III. Salesianergasse 33beschriftet 3/103SCHÄTZPREIS / ESTIMATE °€ 200 - 400STARTPREIS / STARTING PRICE °€ 200Josef Hoffmann, Schüler von Otto Wagner, war als Architekt und Gestalter eine der zentralen Figuren der Wiener Moderne. 1903 gründete er mit Koloman Moser und dem Industrielle Fritz Waerndorfer die Wiener Werkstätte (WW), nach dem Vorbild der britischen Arts and Crafts Movement und unter dem Eindruck des Wiener Jugendstils. Hoffmann, befreundet u. a. mit Gustav Klimt und Anton Hanak, blieb bis zum Konkurs 1932 einer der wichtigsten Gestalter der WW. Die Wiener Werkstätte, bezeichnet auch als Wiener Werkstatt, Vienna Workshop, Wiener Werkstaetten oder Wiener Werkstätten, hatte die Zielsetzung, die gesamten Lebensbereiche des Menschen gestalterisch zu vereinen, im Sinne eines Gesamtkunstwerks. Zu den Kunden zählten hauptsächlich Künstler und die aufstrebende jüdische Ober- und Mittelschicht. Die Bekanntschaft Josef Hoffmanns mit Berta Zuckerkandl führte zum ersten großen Auftrag: dem Sanatorium Purkersdorf, von Viktor Zuckerkandl, Bertas Schwager, westlich von Wien geplant. Unter den Mitarbeitern der WW war auch rund ein Dutzend Frauen, die entscheidend für den Stilwandel vom Jugendstil zum Art Déco der 20er-Jahre waren, z. B. Vally Wieselthier, Gudrun Baudisch, Reni Schaschl, Hilda Jesser und Susi Singer. Die NS-Zeit überstand Josef Hoffmann trotz Anfeindungen des NS-Architekturideologen Paul Schmitthenner unbeschadet. Von der Reichskammer der bildenden Künste wurde er beauftragt, als künstlerischer Leiter den Wiener Kunsthandwerksverein (eine NS-Nachfolgeorganisation des Österreichischen Werkbundes) weiterzuentwickeln. Zu diesem Zweck wurde 1941 eine „künstlerische Versuchsanstalt“ gegründet, in der junge Kunsthandwerker sich unter Hoffmanns Anleitung weiterbilden konnten. Nach dem Krieg, 1948, gründete Hoffmann die Österreichischen Werkstätten als Nachfolgerin von Wiener Werkstätte und Werkbund (ÖWB), dem er bis 1920 angehört hatte. Hoffmanns Grabstein wurde von Fritz Wotruba gestaltet.Bitte beachten: Der Kaufpreis besteht aus Meistbot zuzüglich des Aufgeldes, der Umsatzsteuer sowie gegebenenfalls der Folgerechtsabgabe. Bei Normalbesteuerung (mit ° beim Schätzpreis gekennzeichnet) kommt auf das Meistbot ein Aufgeld in der Höhe von 24% hinzu. Auf die Summe von Meistbot und Aufgeld kommt die gesetzliche Umsatzsteuer hinzu. Diese beträgt 13% bei Gemälden, Aquarellen, Zeichnungen, Grafiken sowie Skulpturen und 20% bei Fotografien und allen anderen Objekten. Bei Differenzbesteuerung beträgt das Aufgeld 28%. Die Umsatzsteuer ist bei der Differenzbesteuerung inkludiert.
JOSEF HOFFMANN* (Pirnitz 1870 - 1956 Wien)Dekorentwurf Mischtechnik/Papier 41,9 x 29,6 cm monogrammiert JH verso gestempelt Prof. Josef Hoffmann Wien III. Salesianergasse 33SCHÄTZPREIS / ESTIMATE °€ 1000 - 2000STARTPREIS / STARTING PRICE °€ 1000Josef Hoffmann, Schüler von Otto Wagner, war als Architekt und Gestalter eine der zentralen Figuren der Wiener Moderne. 1903 gründete er mit Koloman Moser und dem Industrielle Fritz Waerndorfer die Wiener Werkstätte (WW), nach dem Vorbild der britischen Arts and Crafts Movement und unter dem Eindruck des Wiener Jugendstils. Hoffmann, befreundet u. a. mit Gustav Klimt und Anton Hanak, blieb bis zum Konkurs 1932 einer der wichtigsten Gestalter der WW. Die Wiener Werkstätte, bezeichnet auch als Wiener Werkstatt, Vienna Workshop, Wiener Werkstaetten oder Wiener Werkstätten, hatte die Zielsetzung, die gesamten Lebensbereiche des Menschen gestalterisch zu vereinen, im Sinne eines Gesamtkunstwerks. Zu den Kunden zählten hauptsächlich Künstler und die aufstrebende jüdische Ober- und Mittelschicht. Die Bekanntschaft Josef Hoffmanns mit Berta Zuckerkandl führte zum ersten großen Auftrag: dem Sanatorium Purkersdorf, von Viktor Zuckerkandl, Bertas Schwager, westlich von Wien geplant. Unter den Mitarbeitern der WW war auch rund ein Dutzend Frauen, die entscheidend für den Stilwandel vom Jugendstil zum Art Déco der 20er-Jahre waren, z. B. Vally Wieselthier, Gudrun Baudisch, Reni Schaschl, Hilda Jesser und Susi Singer. Die NS-Zeit überstand Josef Hoffmann trotz Anfeindungen des NS-Architekturideologen Paul Schmitthenner unbeschadet. Von der Reichskammer der bildenden Künste wurde er beauftragt, als künstlerischer Leiter den Wiener Kunsthandwerksverein (eine NS-Nachfolgeorganisation des Österreichischen Werkbundes) weiterzuentwickeln. Zu diesem Zweck wurde 1941 eine „künstlerische Versuchsanstalt“ gegründet, in der junge Kunsthandwerker sich unter Hoffmanns Anleitung weiterbilden konnten. Nach dem Krieg, 1948, gründete Hoffmann die Österreichischen Werkstätten als Nachfolgerin von Wiener Werkstätte und Werkbund (ÖWB), dem er bis 1920 angehört hatte. Hoffmanns Grabstein wurde von Fritz Wotruba gestaltet.Bitte beachten: Der Kaufpreis besteht aus Meistbot zuzüglich des Aufgeldes, der Umsatzsteuer sowie gegebenenfalls der Folgerechtsabgabe. Bei Normalbesteuerung (mit ° beim Schätzpreis gekennzeichnet) kommt auf das Meistbot ein Aufgeld in der Höhe von 24% hinzu. Auf die Summe von Meistbot und Aufgeld kommt die gesetzliche Umsatzsteuer hinzu. Diese beträgt 13% bei Gemälden, Aquarellen, Zeichnungen, Grafiken sowie Skulpturen und 20% bei Fotografien und allen anderen Objekten. Bei Differenzbesteuerung beträgt das Aufgeld 28%. Die Umsatzsteuer ist bei der Differenzbesteuerung inkludiert.
JOSEF HOFFMANN* (Pirnitz 1870 - 1956 Wien)Konvolut aus 16 ScherenschnittenBuntpapier in verschiedenen Farben, je circa 21 x 21 cmSCHÄTZPREIS / ESTIMATE °€ 1000 - 2000STARTPREIS / STARTING PRICE °€ 1000Josef Hoffmann, Schüler von Otto Wagner, war als Architekt und Gestalter eine der zentralen Figuren der Wiener Moderne. 1903 gründete er mit Koloman Moser und dem Industrielle Fritz Waerndorfer die Wiener Werkstätte (WW), nach dem Vorbild der britischen Arts and Crafts Movement und unter dem Eindruck des Wiener Jugendstils. Hoffmann, befreundet u. a. mit Gustav Klimt und Anton Hanak, blieb bis zum Konkurs 1932 einer der wichtigsten Gestalter der WW. Die Wiener Werkstätte, bezeichnet auch als Wiener Werkstatt, Vienna Workshop, Wiener Werkstaetten oder Wiener Werkstätten, hatte die Zielsetzung, die gesamten Lebensbereiche des Menschen gestalterisch zu vereinen, im Sinne eines Gesamtkunstwerks. Zu den Kunden zählten hauptsächlich Künstler und die aufstrebende jüdische Ober- und Mittelschicht. Die Bekanntschaft Josef Hoffmanns mit Berta Zuckerkandl führte zum ersten großen Auftrag: dem Sanatorium Purkersdorf, von Viktor Zuckerkandl, Bertas Schwager, westlich von Wien geplant. Unter den Mitarbeitern der WW war auch rund ein Dutzend Frauen, die entscheidend für den Stilwandel vom Jugendstil zum Art Déco der 20er-Jahre waren, z. B. Vally Wieselthier, Gudrun Baudisch, Reni Schaschl, Hilda Jesser und Susi Singer. Die NS-Zeit überstand Josef Hoffmann trotz Anfeindungen des NS-Architekturideologen Paul Schmitthenner unbeschadet. Von der Reichskammer der bildenden Künste wurde er 1939 beauftragt, als künstlerischer Leiter den Wiener Kunsthandwerksverein (eine NS-Nachfolgeorganisation des Österreichischen Werkbundes) weiterzuentwickeln. Zu diesem Zweck wurde 1941 die "Versuchswerkstätte für schöpferische Formgebung“ gegründet, in der junge Kunsthandwerker sich unter Hoffmanns Anleitung weiterbildeten. Hoffmann versuchte so, auf die Geschmackskultur Einfluss zu gewinnen. 1942 verfasste Hoffmann den vorliegenden Bericht. Nach dem Krieg, 1948, gründete Hoffmann die Österreichischen Werkstätten als Nachfolgerin von Wiener Werkstätte und Werkbund (ÖWB), dem er bis 1920 angehört hatte. Hoffmanns Grabstein wurde von Fritz Wotruba gestaltet.Bitte beachten: Der Kaufpreis besteht aus Meistbot zuzüglich des Aufgeldes, der Umsatzsteuer sowie gegebenenfalls der Folgerechtsabgabe. Bei Normalbesteuerung (mit ° beim Schätzpreis gekennzeichnet) kommt auf das Meistbot ein Aufgeld in der Höhe von 24% hinzu. Auf die Summe von Meistbot und Aufgeld kommt die gesetzliche Umsatzsteuer hinzu. Diese beträgt 13% bei Gemälden, Aquarellen, Zeichnungen, Grafiken sowie Skulpturen und 20% bei Fotografien und allen anderen Objekten. Bei Differenzbesteuerung beträgt das Aufgeld 28%. Die Umsatzsteuer ist bei der Differenzbesteuerung inkludiert.
BRUNO REIFFENSTEIN (Wien 1868 - 1951 Wien)Cafe Viennoise auf der Pariser Kunstgewerbe-Ausstellung, 1925Silbergelatineabzug/Papier 43 x 53 cmverso gestempelt Photo Reifenstein Wien VIII. Bennegasse 24, sowie Atelierstempel Josef Hoffmann und händische Beschriftung Pariser Kunstgewerbe-Ausstellung 1925 RestaurantSCHÄTZPREIS / ESTIMATE °€ 200 - 400STARTPREIS / STARTING PRICE °€ 200Die Fotografie des österreichischen Fotografen und Fotoverlegers Bruno Reiffenstein entstammt dem Nachlass von Josef Hoffmann. Reiffenstein besuchte die Graphische Versuchs- und Lehranstalt in Wien. Er hatte ab den 1880er Jahren ein eigenes Atelier in Wien mit den Schwerpunkten Architektur- und Landschaftsfotografie. Anfang des 20. Jahrhunderts gründete er einen Architekturverlag. Während des Ersten Weltkriegs war er Mitarbeiter des Kriegspressequartiers. Reiffensteins Archiv an Architekturfotos diente auch zur Rekonstruktion beschädigter historischer Bauwerke nach dem Zweiten Weltkrieg. Zahlreiche seiner Aufnahmen befinden sich heute im Bestand des Wien Museums und der Österreichischen Nationalbibliothek (Bildarchiv und Grafiksammlung). Josef Hoffmann, Schüler von Otto Wagner, war als Architekt und Gestalter eine der zentralen Figuren der Wiener Moderne. 1903 gründete er mit Koloman Moser und dem Industrielle Fritz Waerndorfer die Wiener Werkstätte (WW), nach dem Vorbild der britischen Arts and Crafts Movement und unter dem Eindruck des Wiener Jugendstils. Hoffmann, befreundet u. a. mit Gustav Klimt und Anton Hanak, blieb bis zum Konkurs 1932 einer der wichtigsten Gestalter der WW. Die Wiener Werkstätte, bezeichnet auch als Wiener Werkstatt, Vienna Workshop, Wiener Werkstaetten oder Wiener Werkstätten, hatte die Zielsetzung, die gesamten Lebensbereiche des Menschen gestalterisch zu vereinen, im Sinne eines Gesamtkunstwerks. Zu den Kunden zählten hauptsächlich Künstler und die aufstrebende jüdische Ober- und Mittelschicht. Die Bekanntschaft Josef Hoffmanns mit Berta Zuckerkandl führte zum ersten großen Auftrag: dem Sanatorium Purkersdorf, von Viktor Zuckerkandl, Bertas Schwager, westlich von Wien geplant. Unter den Mitarbeitern der WW war auch rund ein Dutzend Frauen, die entscheidend für den Stilwandel vom Jugendstil zum Art Déco der 20er-Jahre waren, z. B. Vally Wieselthier, Gudrun Baudisch, Reni Schaschl, Hilda Jesser und Susi Singer. Nach dem Krieg, 1948, gründete Hoffmann die Österreichischen Werkstätten als Nachfolgerin von Wiener Werkstätte und Werkbund (ÖWB). Hoffmanns Grabstein wurde von Fritz Wotruba gestaltet. Das Café viennois war ein Bestandteil von Josef Hoffmanns berühmtem Österreichischem Pavillon für die Exposition Internationale des Arts Decoratifs in Paris (1925). Architekt des Cafés, das sich im Terassentrakt des Pavillons befand, war Josef Frank (1885 - 1967). Der Terrassentrakt enthielt ferner einen Orgelturm nach Entwurf Oskar Strnads und ein expressionistisches Glashaus von Peter Behrens.Bitte beachten: Der Kaufpreis besteht aus Meistbot zuzüglich des Aufgeldes, der Umsatzsteuer sowie gegebenenfalls der Folgerechtsabgabe. Bei Normalbesteuerung (mit ° beim Schätzpreis gekennzeichnet) kommt auf das Meistbot ein Aufgeld in der Höhe von 24% hinzu. Auf die Summe von Meistbot und Aufgeld kommt die gesetzliche Umsatzsteuer hinzu. Diese beträgt 13% bei Gemälden, Aquarellen, Zeichnungen, Grafiken sowie Skulpturen und 20% bei Fotografien und allen anderen Objekten. Bei Differenzbesteuerung beträgt das Aufgeld 28%. Die Umsatzsteuer ist bei der Differenzbesteuerung inkludiert.
JOSEF HOFFMANN* (Pirnitz 1870 - 1956 Wien)Entwurf eines DeckelpokalesBleistift und Tusche/Papier 26,4 x 16 cmverso Atelierstempel Josef HoffmannSCHÄTZPREIS / ESTIMATE °€ 600 - 1200STARTPREIS / STARTING PRICE °€ 600Josef Hoffmann, Schüler von Otto Wagner, war als Architekt und Gestalter eine der zentralen Figuren der Wiener Moderne. 1903 gründete er mit Koloman Moser und dem Industrielle Fritz Waerndorfer die Wiener Werkstätte (WW), nach dem Vorbild der britischen Arts and Crafts Movement und unter dem Eindruck des Wiener Jugendstils. Hoffmann, befreundet u. a. mit Gustav Klimt und Anton Hanak, blieb bis zum Konkurs 1932 einer der wichtigsten Gestalter der WW. Die Wiener Werkstätte, bezeichnet auch als Wiener Werkstatt, Vienna Workshop, Wiener Werkstaetten oder Wiener Werkstätten, hatte die Zielsetzung, die gesamten Lebensbereiche des Menschen gestalterisch zu vereinen, im Sinne eines Gesamtkunstwerks. Zu den Kunden zählten hauptsächlich Künstler und die aufstrebende jüdische Ober- und Mittelschicht. Die Bekanntschaft Josef Hoffmanns mit Berta Zuckerkandl führte zum ersten großen Auftrag: dem Sanatorium Purkersdorf, von Viktor Zuckerkandl, Bertas Schwager, westlich von Wien geplant. Unter den Mitarbeitern der WW war auch rund ein Dutzend Frauen, die entscheidend für den Stilwandel vom Jugendstil zum Art Déco der 20er-Jahre waren, z. B. Vally Wieselthier, Gudrun Baudisch, Reni Schaschl, Hilda Jesser und Susi Singer. Die NS-Zeit überstand Josef Hoffmann trotz Anfeindungen des NS-Architekturideologen Paul Schmitthenner unbeschadet. Von der Reichskammer der bildenden Künste wurde er beauftragt, als künstlerischer Leiter den Wiener Kunsthandwerksverein (eine NS-Nachfolgeorganisation des Österreichischen Werkbundes) weiterzuentwickeln. Zu diesem Zweck wurde 1941 eine „künstlerische Versuchsanstalt“ gegründet, in der junge Kunsthandwerker sich unter Hoffmanns Anleitung weiterbilden konnten. Nach dem Krieg, 1948, gründete Hoffmann die Österreichischen Werkstätten als Nachfolgerin von Wiener Werkstätte und Werkbund (ÖWB), dem er bis 1920 angehört hatte. Hoffmanns Grabstein wurde von Fritz Wotruba gestaltet.Bitte beachten: Der Kaufpreis besteht aus Meistbot zuzüglich des Aufgeldes, der Umsatzsteuer sowie gegebenenfalls der Folgerechtsabgabe. Bei Normalbesteuerung (mit ° beim Schätzpreis gekennzeichnet) kommt auf das Meistbot ein Aufgeld in der Höhe von 24% hinzu. Auf die Summe von Meistbot und Aufgeld kommt die gesetzliche Umsatzsteuer hinzu. Diese beträgt 13% bei Gemälden, Aquarellen, Zeichnungen, Grafiken sowie Skulpturen und 20% bei Fotografien und allen anderen Objekten. Bei Differenzbesteuerung beträgt das Aufgeld 28%. Die Umsatzsteuer ist bei der Differenzbesteuerung inkludiert.
JOSEF HOFFMANN* (Pirnitz 1870 - 1956 Wien)Manifest zur Wiener Secession Tinte/Papier 29,7 x 21 cm handschriftlich verfasst von Josef Hoffmann, undatiertSCHÄTZPREIS / ESTIMATE °€ 300 - 600STARTPREIS / STARTING PRICE °€ 300Josef Hoffmann, Schüler von Otto Wagner, war als Architekt und Gestalter eine der zentralen Figuren der Wiener Moderne. 1903 gründete er mit Koloman Moser und dem Industrielle Fritz Waerndorfer die Wiener Werkstätte (WW), nach dem Vorbild der britischen Arts and Crafts Movement und unter dem Eindruck des Wiener Jugendstils. Hoffmann, befreundet u. a. mit Gustav Klimt und Anton Hanak, blieb bis zum Konkurs 1932 einer der wichtigsten Gestalter der WW. Die Wiener Werkstätte, bezeichnet auch als Wiener Werkstatt, Vienna Workshop, Wiener Werkstaetten oder Wiener Werkstätten, hatte die Zielsetzung, die gesamten Lebensbereiche des Menschen gestalterisch zu vereinen, im Sinne eines Gesamtkunstwerks. Zu den Kunden zählten hauptsächlich Künstler und die aufstrebende jüdische Ober- und Mittelschicht. Die Bekanntschaft Josef Hoffmanns mit Berta Zuckerkandl führte zum ersten großen Auftrag: dem Sanatorium Purkersdorf, von Viktor Zuckerkandl, Bertas Schwager, westlich von Wien geplant. Unter den Mitarbeitern der WW war auch rund ein Dutzend Frauen, die entscheidend für den Stilwandel vom Jugendstil zum Art Déco der 20er-Jahre waren, z. B. Vally Wieselthier, Gudrun Baudisch, Reni Schaschl, Hilda Jesser und Susi Singer. Die NS-Zeit überstand Josef Hoffmann trotz Anfeindungen des NS-Architekturideologen Paul Schmitthenner unbeschadet. Von der Reichskammer der bildenden Künste wurde er 1939 beauftragt, als künstlerischer Leiter den Wiener Kunsthandwerksverein (eine NS-Nachfolgeorganisation des Österreichischen Werkbundes) weiterzuentwickeln. Zu diesem Zweck wurde 1941 die "Versuchswerkstätte für schöpferische Formgebung“ gegründet, in der junge Kunsthandwerker sich unter Hoffmanns Anleitung weiterbildeten. Hoffmann versuchte so, auf die Geschmackskultur Einfluss zu gewinnen. 1942 verfasste Hoffmann den vorliegenden Bericht. Nach dem Krieg, 1948, gründete Hoffmann die Österreichischen Werkstätten als Nachfolgerin von Wiener Werkstätte und Werkbund (ÖWB), dem er bis 1920 angehört hatte. Hoffmanns Grabstein wurde von Fritz Wotruba gestaltet.Bitte beachten: Der Kaufpreis besteht aus Meistbot zuzüglich des Aufgeldes, der Umsatzsteuer sowie gegebenenfalls der Folgerechtsabgabe. Bei Normalbesteuerung (mit ° beim Schätzpreis gekennzeichnet) kommt auf das Meistbot ein Aufgeld in der Höhe von 24% hinzu. Auf die Summe von Meistbot und Aufgeld kommt die gesetzliche Umsatzsteuer hinzu. Diese beträgt 13% bei Gemälden, Aquarellen, Zeichnungen, Grafiken sowie Skulpturen und 20% bei Fotografien und allen anderen Objekten. Bei Differenzbesteuerung beträgt das Aufgeld 28%. Die Umsatzsteuer ist bei der Differenzbesteuerung inkludiert.
EGON SCHIELE (Tulln an der Donau 1890 - 1918 Wien)Selbstbildnis, um 1917Bronze 28 x 16,5 x 21 cmPunze an der Seite: Egon Schiele IX/XXX (C) 1980Punze Unten: Venturi ArteEdition IX/XXX, Copyright 1980 von Venturi ArteSCHÄTZPREIS / ESTIMATE € 2000 - 3000STARTPREIS / STARTING PRICE € 2000Egon Schiele begann bereits 1906, mit nur 16 Jahren, ein Studium der Malerei an der Akademie der bildenden Künste in Wien. Zwei Jahre später verließ er die Akademie, weil ihn der starre Lehrplan zu stark einschränkte und gründete die "Neukunstgruppe" (Anton Peschka Anton Faistauer, Rudolf Kalvach, Hans Böhler, Erwin Osen, Franz Wiegele, Robin Christian Andersen, Arthur Löwenstein; später auch Oskar Kokoschka, Karl Hofer, Sebastian Isepp, Albert Paris Gütersloh und Anton Kolig); im selben Jahr hatte er seine erste öffentliche Ausstellung. Frühen prägenden Einfluss hatte der Kontakt zu Gustav Klimt. Die Abkehr vom Jugenstil und zunehmende Hinwendung zu Expressionismus wurde durch die Freundschaft zu Max Oppenheimer ausgelöst. 1911 lebte Schiele zunächst in Krumau und anschließend in Neulengbach. Seine Aktdarstellungen führten zu einer Verurteilung wegen der "Verbreitung unsittlicher Zeichnungen" und einem 24-tägigen Gefängnisaufenthalt im gleichen Jahr. 1912 zog Schiele wieder nach Wien. Seine Karriere entwickelte sich kontinuierlich und wurde 1918 vom frühen Tod durch eine Erkrankung an der Spanischen Grippe, der auch Schieles Frau Edith erlag, jäh unterbrochen.Bitte beachten: Der Kaufpreis besteht aus Meistbot zuzüglich des Aufgeldes, der Umsatzsteuer sowie gegebenenfalls der Folgerechtsabgabe. Bei Normalbesteuerung (mit ° beim Schätzpreis gekennzeichnet) kommt auf das Meistbot ein Aufgeld in der Höhe von 24% hinzu. Auf die Summe von Meistbot und Aufgeld kommt die gesetzliche Umsatzsteuer hinzu. Diese beträgt 13% bei Gemälden, Aquarellen, Zeichnungen, Grafiken sowie Skulpturen und 20% bei Fotografien und allen anderen Objekten. Bei Differenzbesteuerung beträgt das Aufgeld 28%. Die Umsatzsteuer ist bei der Differenzbesteuerung inkludiert.
EGON SCHIELE (Tulln an der Donau 1890 - 1918 Wien)Bildnis Franz Hauer, 1914Kaltnadelradierung/Papier 13 x 11 cmEdition von 1969 von Otto Kallirverso monogrammiert und datiert OK 1969, sowie nummeriert 59/60, prachtvoller DruckProvenienz Sammlung Chrastek, WienSCHÄTZPREIS / ESTIMATE € 1600 - 3000STARTPREIS / STARTING PRICE € 1600Egon Schiele begann bereits 1906, mit nur 16 Jahren, ein Studium der Malerei an der Akademie der bildenden Künste in Wien. Zwei Jahre später verließ er die Akademie, weil ihn der starre Lehrplan zu stark einschränkte und gründete die "Neukunstgruppe" (Anton Peschka Anton Faistauer, Rudolf Kalvach, Hans Böhler, Erwin Osen, Franz Wiegele, Robin Christian Andersen, Arthur Löwenstein; später auch Oskar Kokoschka, Karl Hofer, Sebastian Isepp, Albert Paris Gütersloh und Anton Kolig); im selben Jahr hatte er seine erste öffentliche Ausstellung. Frühen prägenden Einfluss hatte der Kontakt zu Gustav Klimt. Die Abkehr vom Jugenstil und zunehmende Hinwendung zu Expressionismus wurde durch die Freundschaft zu Max Oppenheimer ausgelöst. 1909 erkannte der Kunstkritiker und Publizist Arthur Roessler die Bedeutung Schieles. In der Folge rühret er für den jungen Künstler die Werbetrommel, führt ihn in die Wiener Sammlerzirkel ein und vermittelt ihm seine ersten Aufträge. Auch in Roesslers eigener Stsammlung war Schiele mit einer exzellenten Werkauswahl vertreten. 1911 lebte Schiele in Krumau und anschließend in Neulengbach. Seine Aktdarstellungen führten zu einer Verurteilung wegen der "Verbreitung unsittlicher Zeichnungen" und einem 24-tägigen Gefängnisaufenthalt im gleichen Jahr. 1912 zog Schiele wieder nach Wien. Seine Karriere entwickelte sich kontinuierlich und wurde 1918 vom frühen Tod durch eine Erkrankung an der Spanischen Grippe, der auch Schieles Frau Edith erlag, jäh unterbrochen. Bitte beachten: Der Kaufpreis besteht aus Meistbot zuzüglich des Aufgeldes, der Umsatzsteuer sowie gegebenenfalls der Folgerechtsabgabe. Bei Normalbesteuerung (mit ° beim Schätzpreis gekennzeichnet) kommt auf das Meistbot ein Aufgeld in der Höhe von 24% hinzu. Auf die Summe von Meistbot und Aufgeld kommt die gesetzliche Umsatzsteuer hinzu. Diese beträgt 13% bei Gemälden, Aquarellen, Zeichnungen, Grafiken sowie Skulpturen und 20% bei Fotografien und allen anderen Objekten. Bei Differenzbesteuerung beträgt das Aufgeld 28%. Die Umsatzsteuer ist bei der Differenzbesteuerung inkludiert.
JOSEF HOFFMANN* (Pirnitz 1870 - 1956 Wien)Kannen mit BlätterkranzTinte/Papier 20,7 x 29,5 cmmonogrammiert JHverso Atelierstempel Josef HoffmannSCHÄTZPREIS / ESTIMATE °€ 250 - 500STARTPREIS / STARTING PRICE °€ 250Josef Hoffmann, Schüler von Otto Wagner, war als Architekt und Gestalter eine der zentralen Figuren der Wiener Moderne. 1903 gründete er mit Koloman Moser und dem Industrielle Fritz Waerndorfer die Wiener Werkstätte (WW), nach dem Vorbild der britischen Arts and Crafts Movement und unter dem Eindruck des Wiener Jugendstils. Hoffmann, befreundet u. a. mit Gustav Klimt und Anton Hanak, blieb bis zum Konkurs 1932 einer der wichtigsten Gestalter der WW. Die Wiener Werkstätte, bezeichnet auch als Wiener Werkstatt, Vienna Workshop, Wiener Werkstaetten oder Wiener Werkstätten, hatte die Zielsetzung, die gesamten Lebensbereiche des Menschen gestalterisch zu vereinen, im Sinne eines Gesamtkunstwerks. Zu den Kunden zählten hauptsächlich Künstler und die aufstrebende jüdische Ober- und Mittelschicht. Die Bekanntschaft Josef Hoffmanns mit Berta Zuckerkandl führte zum ersten großen Auftrag: dem Sanatorium Purkersdorf, von Viktor Zuckerkandl, Bertas Schwager, westlich von Wien geplant. Unter den Mitarbeitern der WW war auch rund ein Dutzend Frauen, die entscheidend für den Stilwandel vom Jugendstil zum Art Déco der 20er-Jahre waren, z. B. Vally Wieselthier, Gudrun Baudisch, Reni Schaschl, Hilda Jesser und Susi Singer. Die NS-Zeit überstand Josef Hoffmann trotz Anfeindungen des NS-Architekturideologen Paul Schmitthenner unbeschadet. Von der Reichskammer der bildenden Künste wurde er beauftragt, als künstlerischer Leiter den Wiener Kunsthandwerksverein (eine NS-Nachfolgeorganisation des Österreichischen Werkbundes) weiterzuentwickeln. Zu diesem Zweck wurde 1941 eine „künstlerische Versuchsanstalt“ gegründet, in der junge Kunsthandwerker sich unter Hoffmanns Anleitung weiterbilden konnten. Nach dem Krieg, 1948, gründete Hoffmann die Österreichischen Werkstätten als Nachfolgerin von Wiener Werkstätte und Werkbund (ÖWB), dem er bis 1920 angehört hatte. Hoffmanns Grabstein wurde von Fritz Wotruba gestaltet.Bitte beachten: Der Kaufpreis besteht aus Meistbot zuzüglich des Aufgeldes, der Umsatzsteuer sowie gegebenenfalls der Folgerechtsabgabe. Bei Normalbesteuerung (mit ° beim Schätzpreis gekennzeichnet) kommt auf das Meistbot ein Aufgeld in der Höhe von 24% hinzu. Auf die Summe von Meistbot und Aufgeld kommt die gesetzliche Umsatzsteuer hinzu. Diese beträgt 13% bei Gemälden, Aquarellen, Zeichnungen, Grafiken sowie Skulpturen und 20% bei Fotografien und allen anderen Objekten. Bei Differenzbesteuerung beträgt das Aufgeld 28%. Die Umsatzsteuer ist bei der Differenzbesteuerung inkludiert.
UNBEKANNTE FOTOGRAFIN/ UNBEKANNTER FOTOGRAF (Lebensdaten unbekannt)Österreichischer PavillonInternationale Kunstausstellung, Rom 1911Konvolut von 7 Silbergelatineabzügen/PapierSechs Fotografien je ca. 8 x 10 cm, eines 24,8 x 18,8 cmteilweise beschriftet Rom 1911 und mit Atelierstempel Josef Hoffmann versehenSCHÄTZPREIS / ESTIMATE °€ 700 - 1400STARTPREIS / STARTING PRICE °€ 700Josef Hoffmann, Schüler von Otto Wagner, war als Architekt und Gestalter eine der zentralen Figuren der Wiener Moderne. 1903 gründete er mit Koloman Moser und dem Industrielle Fritz Waerndorfer die Wiener Werkstätte (WW), nach dem Vorbild der britischen Arts and Crafts Movement und unter dem Eindruck des Wiener Jugendstils. Hoffmann, befreundet u. a. mit Gustav Klimt und Anton Hanak, blieb bis zum Konkurs 1932 einer der wichtigsten Gestalter der WW. Die Wiener Werkstätte, bezeichnet auch als Wiener Werkstatt, Vienna Workshop, Wiener Werkstaetten oder Wiener Werkstätten, hatte die Zielsetzung, die gesamten Lebensbereiche des Menschen gestalterisch zu vereinen, im Sinne eines Gesamtkunstwerks. Zu den Kunden zählten hauptsächlich Künstler und die aufstrebende jüdische Ober- und Mittelschicht. Die Bekanntschaft Josef Hoffmanns mit Berta Zuckerkandl führte zum ersten großen Auftrag: dem Sanatorium Purkersdorf, von Viktor Zuckerkandl, Bertas Schwager, westlich von Wien geplant. Unter den Mitarbeitern der WW war auch rund ein Dutzend Frauen, die entscheidend für den Stilwandel vom Jugendstil zum Art Déco der 20er-Jahre waren, z. B. Vally Wieselthier, Gudrun Baudisch, Reni Schaschl, Hilda Jesser und Susi Singer. Die NS-Zeit überstand Josef Hoffmann trotz Anfeindungen des NS-Architekturideologen Paul Schmitthenner unbeschadet. Von der Reichskammer der bildenden Künste wurde er beauftragt, als künstlerischer Leiter den Wiener Kunsthandwerksverein (eine NS-Nachfolgeorganisation des Österreichischen Werkbundes) weiterzuentwickeln. Zu diesem Zweck wurde 1941 eine „künstlerische Versuchsanstalt“ gegründet, in der junge Kunsthandwerker sich unter Hoffmanns Anleitung weiterbilden konnten. Nach dem Krieg, 1948, gründete Hoffmann die Österreichischen Werkstätten als Nachfolgerin von Wiener Werkstätte und Werkbund (ÖWB), dem er bis 1920 angehört hatte. Hoffmanns Grabstein wurde von Fritz Wotruba gestaltet.Bitte beachten: Der Kaufpreis besteht aus Meistbot zuzüglich des Aufgeldes, der Umsatzsteuer sowie gegebenenfalls der Folgerechtsabgabe. Bei Normalbesteuerung (mit ° beim Schätzpreis gekennzeichnet) kommt auf das Meistbot ein Aufgeld in der Höhe von 24% hinzu. Auf die Summe von Meistbot und Aufgeld kommt die gesetzliche Umsatzsteuer hinzu. Diese beträgt 13% bei Gemälden, Aquarellen, Zeichnungen, Grafiken sowie Skulpturen und 20% bei Fotografien und allen anderen Objekten. Bei Differenzbesteuerung beträgt das Aufgeld 28%. Die Umsatzsteuer ist bei der Differenzbesteuerung inkludiert.
JOSEF HOFFMANN* (Pirnitz 1870 - 1956 Wien)Konvolut aus drei Schriften Schreibmaschine und Tinte/Papier 29,7 x 21 cm 1) Manifest zum Wiederaufbau der Wiener Seccession, August 1945, zweiseitiges Typoskript mit handschriftlichen Korrekturen von Josef Hoffmann, datiert August 1945 2) Resolution von Ernst Huber, 1954, Misstrauensantrag gegen Secessionspräsident Meissner, signiert und datiert Ernst Huber, September 1954 3) Mitgliederliste der Wiener SecessionSCHÄTZPREIS / ESTIMATE °€ 400 - 600STARTPREIS / STARTING PRICE °€ 400Josef Hoffmann, Schüler von Otto Wagner, war als Architekt und Gestalter eine der zentralen Figuren der Wiener Moderne. 1903 gründete er mit Koloman Moser und dem Industrielle Fritz Waerndorfer die Wiener Werkstätte (WW), nach dem Vorbild der britischen Arts and Crafts Movement und unter dem Eindruck des Wiener Jugendstils. Hoffmann, befreundet u. a. mit Gustav Klimt und Anton Hanak, blieb bis zum Konkurs 1932 einer der wichtigsten Gestalter der WW. Die Wiener Werkstätte, bezeichnet auch als Wiener Werkstatt, Vienna Workshop, Wiener Werkstaetten oder Wiener Werkstätten, hatte die Zielsetzung, die gesamten Lebensbereiche des Menschen gestalterisch zu vereinen, im Sinne eines Gesamtkunstwerks. Zu den Kunden zählten hauptsächlich Künstler und die aufstrebende jüdische Ober- und Mittelschicht. Die Bekanntschaft Josef Hoffmanns mit Berta Zuckerkandl führte zum ersten großen Auftrag: dem Sanatorium Purkersdorf, von Viktor Zuckerkandl, Bertas Schwager, westlich von Wien geplant. Unter den Mitarbeitern der WW war auch rund ein Dutzend Frauen, die entscheidend für den Stilwandel vom Jugendstil zum Art Déco der 20er-Jahre waren, z. B. Vally Wieselthier, Gudrun Baudisch, Reni Schaschl, Hilda Jesser und Susi Singer. Die NS-Zeit überstand Josef Hoffmann trotz Anfeindungen des NS-Architekturideologen Paul Schmitthenner unbeschadet. Von der Reichskammer der bildenden Künste wurde er 1939 beauftragt, als künstlerischer Leiter den Wiener Kunsthandwerksverein (eine NS-Nachfolgeorganisation des Österreichischen Werkbundes) weiterzuentwickeln. Zu diesem Zweck wurde 1941 die "Versuchswerkstätte für schöpferische Formgebung“ gegründet, in der junge Kunsthandwerker sich unter Hoffmanns Anleitung weiterbildeten. Hoffmann versuchte so, auf die Geschmackskultur Einfluss zu gewinnen. 1942 verfasste Hoffmann den vorliegenden Bericht. Nach dem Krieg, 1948, gründete Hoffmann die Österreichischen Werkstätten als Nachfolgerin von Wiener Werkstätte und Werkbund (ÖWB), dem er bis 1920 angehört hatte. Hoffmanns Grabstein wurde von Fritz Wotruba gestaltet.Bitte beachten: Der Kaufpreis besteht aus Meistbot zuzüglich des Aufgeldes, der Umsatzsteuer sowie gegebenenfalls der Folgerechtsabgabe. Bei Normalbesteuerung (mit ° beim Schätzpreis gekennzeichnet) kommt auf das Meistbot ein Aufgeld in der Höhe von 24% hinzu. Auf die Summe von Meistbot und Aufgeld kommt die gesetzliche Umsatzsteuer hinzu. Diese beträgt 13% bei Gemälden, Aquarellen, Zeichnungen, Grafiken sowie Skulpturen und 20% bei Fotografien und allen anderen Objekten. Bei Differenzbesteuerung beträgt das Aufgeld 28%. Die Umsatzsteuer ist bei der Differenzbesteuerung inkludiert.
JOSEF HOFFMANN* (Pirnitz 1870 - 1956 Wien)Kleiner MessingkelchMessing 8,7 x 9 cmgemarkt WW, JH (Wiener Werkstätte, Josef Hoffmann)SCHÄTZPREIS / ESTIMATE °€ 800 - 1200STARTPREIS / STARTING PRICE °€ 800Josef Hoffmann, Schüler von Otto Wagner, war als Architekt und Gestalter eine der zentralen Figuren der Wiener Moderne. 1903 gründete er mit Koloman Moser und dem Industrielle Fritz Waerndorfer die Wiener Werkstätte (WW), nach dem Vorbild der britischen Arts and Crafts Movement und unter dem Eindruck des Wiener Jugendstils. Hoffmann, befreundet u. a. mit Gustav Klimt und Anton Hanak, blieb bis zum Konkurs 1932 einer der wichtigsten Gestalter der WW. Die Wiener Werkstätte, bezeichnet auch als Wiener Werkstatt, Vienna Workshop, Wiener Werkstaetten oder Wiener Werkstätten, hatte die Zielsetzung, die gesamten Lebensbereiche des Menschen gestalterisch zu vereinen, im Sinne eines Gesamtkunstwerks. Zu den Kunden zählten hauptsächlich Künstler und die aufstrebende jüdische Ober- und Mittelschicht. Die Bekanntschaft Josef Hoffmanns mit Berta Zuckerkandl führte zum ersten großen Auftrag: dem Sanatorium Purkersdorf, von Viktor Zuckerkandl, Bertas Schwager, westlich von Wien geplant. Unter den Mitarbeitern der WW war auch rund ein Dutzend Frauen, die entscheidend für den Stilwandel vom Jugendstil zum Art Déco der 20er-Jahre waren, z. B. Vally Wieselthier, Gudrun Baudisch, Reni Schaschl, Hilda Jesser und Susi Singer. Die NS-Zeit überstand Josef Hoffmann trotz Anfeindungen des NS-Architekturideologen Paul Schmitthenner unbeschadet. Von der Reichskammer der bildenden Künste wurde er beauftragt, als künstlerischer Leiter den Wiener Kunsthandwerksverein (eine NS-Nachfolgeorganisation des Österreichischen Werkbundes) weiterzuentwickeln. Zu diesem Zweck wurde 1941 eine „künstlerische Versuchsanstalt“ gegründet, in der junge Kunsthandwerker sich unter Hoffmanns Anleitung weiterbilden konnten. Nach dem Krieg, 1948, gründete Hoffmann die Österreichischen Werkstätten als Nachfolgerin von Wiener Werkstätte und Werkbund (ÖWB), dem er bis 1920 angehört hatte. Hoffmanns Grabstein wurde von Fritz Wotruba gestaltet.Bitte beachten: Der Kaufpreis besteht aus Meistbot zuzüglich des Aufgeldes, der Umsatzsteuer sowie gegebenenfalls der Folgerechtsabgabe. Bei Normalbesteuerung (mit ° beim Schätzpreis gekennzeichnet) kommt auf das Meistbot ein Aufgeld in der Höhe von 24% hinzu. Auf die Summe von Meistbot und Aufgeld kommt die gesetzliche Umsatzsteuer hinzu. Diese beträgt 13% bei Gemälden, Aquarellen, Zeichnungen, Grafiken sowie Skulpturen und 20% bei Fotografien und allen anderen Objekten. Bei Differenzbesteuerung beträgt das Aufgeld 28%. Die Umsatzsteuer ist bei der Differenzbesteuerung inkludiert.
JOSEF HOFFMANN* (Pirnitz 1870 - 1956 Wien)Dekorentwurf, um 1935Tusche und Bleistift/Papier 42,2 x 29,9 cmmonogrammiert JHverso Atelierstempel Josef Hoffmann und nummeriert D/32montiert auf Papierabgebildet in Kristan/Bogner, Der späte Josef Hoffmann 2023, S. 169SCHÄTZPREIS / ESTIMATE °€ 1000 - 2000STARTPREIS / STARTING PRICE °€ 1000Josef Hoffmann, Schüler von Otto Wagner, war als Architekt und Gestalter eine der zentralen Figuren der Wiener Moderne. 1903 gründete er mit Koloman Moser und dem Industrielle Fritz Waerndorfer die Wiener Werkstätte (WW), nach dem Vorbild der britischen Arts and Crafts Movement und unter dem Eindruck des Wiener Jugendstils. Hoffmann, befreundet u. a. mit Gustav Klimt und Anton Hanak, blieb bis zum Konkurs 1932 einer der wichtigsten Gestalter der WW. Die Wiener Werkstätte, bezeichnet auch als Wiener Werkstatt, Vienna Workshop, Wiener Werkstaetten oder Wiener Werkstätten, hatte die Zielsetzung, die gesamten Lebensbereiche des Menschen gestalterisch zu vereinen, im Sinne eines Gesamtkunstwerks. Zu den Kunden zählten hauptsächlich Künstler und die aufstrebende jüdische Ober- und Mittelschicht. Die Bekanntschaft Josef Hoffmanns mit Berta Zuckerkandl führte zum ersten großen Auftrag: dem Sanatorium Purkersdorf, von Viktor Zuckerkandl, Bertas Schwager, westlich von Wien geplant. Unter den Mitarbeitern der WW war auch rund ein Dutzend Frauen, die entscheidend für den Stilwandel vom Jugendstil zum Art Déco der 20er-Jahre waren, z. B. Vally Wieselthier, Gudrun Baudisch, Reni Schaschl, Hilda Jesser und Susi Singer. Die NS-Zeit überstand Josef Hoffmann trotz Anfeindungen des NS-Architekturideologen Paul Schmitthenner unbeschadet. Von der Reichskammer der bildenden Künste wurde er beauftragt, als künstlerischer Leiter den Wiener Kunsthandwerksverein (eine NS-Nachfolgeorganisation des Österreichischen Werkbundes) weiterzuentwickeln. Zu diesem Zweck wurde 1941 eine „künstlerische Versuchsanstalt“ gegründet, in der junge Kunsthandwerker sich unter Hoffmanns Anleitung weiterbilden konnten. Nach dem Krieg, 1948, gründete Hoffmann die Österreichischen Werkstätten als Nachfolgerin von Wiener Werkstätte und Werkbund (ÖWB), dem er bis 1920 angehört hatte. Hoffmanns Grabstein wurde von Fritz Wotruba gestaltet.Bitte beachten: Der Kaufpreis besteht aus Meistbot zuzüglich des Aufgeldes, der Umsatzsteuer sowie gegebenenfalls der Folgerechtsabgabe. Bei Normalbesteuerung (mit ° beim Schätzpreis gekennzeichnet) kommt auf das Meistbot ein Aufgeld in der Höhe von 24% hinzu. Auf die Summe von Meistbot und Aufgeld kommt die gesetzliche Umsatzsteuer hinzu. Diese beträgt 13% bei Gemälden, Aquarellen, Zeichnungen, Grafiken sowie Skulpturen und 20% bei Fotografien und allen anderen Objekten. Bei Differenzbesteuerung beträgt das Aufgeld 28%. Die Umsatzsteuer ist bei der Differenzbesteuerung inkludiert.
GUSTINUS AMBROSI* (Eisenstadt 1893 - 1975 Wien)SchildkröteBronze 3,8 x 6 x 10 cmmonogrammiert Anummeriert 1/7SCHÄTZPREIS / ESTIMATE °€ 150 - 250STARTPREIS / STARTING PRICE °€ 150Gustinus (August Arthur) Ambrosi war ein österreichischer Künstler. Der Vater, Friedrich Ambrosi, war Offizier der k.u.k. Armee, Chorleiter und Komponist und ein Freund von Johannes Brahms und Joseph Joachim. Die Mutter, Natalie Ambrosi, geborene de Lángh, dichtete und spielte ausgezeichnet Klavier. Sohn August spielte als Sechsjähriger in Quartetten die Geige. 1899 zog die Familie nach Prag. 1900 verlor August durch eine Meningitis-Erkrankung sein Gehör. 1902 bis 1906 lernte er als Schüler des Prager Privat-Taubstummeninstituts Modellieren und Schnitzen. 1906 war er Praktikant, ab 1907 Lehrling im größten Prager Bildhauer- und Stuckateurunternehmen „Jakob Kozourek“. Nach dem Tod des Vaters übersiedelte die Familie 1909 nach Graz, wo Gustinus die Lehre bei der Firma Suppan, Haushofer und Nikisch bis 1911 fortsetzte. Noch als Lehrling besuchte er die Meisterklasse für Modelleure der Grazer k.u.k. Staatsgewerbeschule, gefördert vom Bildhauer Georg Winkler. Erste Anerkennung erfuhr Ambrosi mit dem Werk "Der Mann mit dem gebrochenen Genick" (1909): Der 16-Jährige wurde in die Genossenschaft bildender Künstler Steiermarks aufgenommen. 1910 bis 1912 beteiligte er sich an Kollektivausstellungen im Grazer Landesmuseum; 1912 wurde ihm der Staatspreis für Plastik verliehen. 1913 erhielt er nach Fürsprache des k.u.k. Statthalters der Steiermark, Graf Manfred von Clary-Aldringen durch Kaiser Franz Joseph I. ein Staatsatelier auf Lebenszeit in Wien. Zur weiteren Ausbildung übersiedelte Ambrosi 1912 mit seiner Mutter nach Wien und studierte bis 1914 als außerordentlicher Hörer an der Akademie der bildenden Künste (Gasthörer war er bei Josef Müllner und Edmund Hellmer, bei Kaspar von Zumbusch hatte er Privatunterricht). Ambrosi korrespondierte mit Felix Braun, Stefan Zweig, Anton Wildgans, Franz Karl Ginzkey, Alfons Petzold, Franz Theodor Csokor oder Arthur Fischer-Colbrie, die er teilweise porträtierte. Zu seinem Hauptwerk "Promethidenlos" (1916–1918) wurde er durch Gerhart Hauptmanns gleichnamige Versdichtung inspiriert; 1914 hatte er den Dichter in Agnetendorf porträtiert. Ambrosi arbeitete in vielen Großstädten Europas (Amsterdam, Brüssel, Antwerpen, Paris, Rom, Basel, Zürich, Köln und anderen) und besaß Ateliers in Rom, Paris und Köln. Im Auftrag des österreichischen Außenministeriums schuf Ambrosi 1924 eine Mussolini-Büste. 1925 vertrat Ambrosi als Kommissär Österreich bei der III. Biennale in Rom und präsentierte dort Arbeiten von Alfons Walde, Gustav Klimt, Egon Schiele, Alfred Kubin, Anton Faistauer und Franz Barwig. Jan Tabor nannte Ambrosi den „prominenten Bildhauer sämtlicher österreichischer Staatsformen dieses Jahrhunderts“.Bitte beachten: Der Kaufpreis besteht aus Meistbot zuzüglich des Aufgeldes, der Umsatzsteuer sowie gegebenenfalls der Folgerechtsabgabe. Bei Normalbesteuerung (mit ° beim Schätzpreis gekennzeichnet) kommt auf das Meistbot ein Aufgeld in der Höhe von 24% hinzu. Auf die Summe von Meistbot und Aufgeld kommt die gesetzliche Umsatzsteuer hinzu. Diese beträgt 13% bei Gemälden, Aquarellen, Zeichnungen, Grafiken sowie Skulpturen und 20% bei Fotografien und allen anderen Objekten. Bei Differenzbesteuerung beträgt das Aufgeld 28%. Die Umsatzsteuer ist bei der Differenzbesteuerung inkludiert.
ERWIN STOLZ* (Gießhübl-Sauerbrunn 1896 - 1987 Wien)SonntagMischtechnik/Papier 47 x 31 cmmonogrammiert ESTverso beschriftet SonntagSCHÄTZPREIS / ESTIMATE °€ 1000 - 2000STARTPREIS / STARTING PRICE °€ 1000Der österreichische Künstler Erwin Stolz erhielt eine Ausbildung zum Agraringenieur, doch in seiner Freizeit beschäftigte er sich intensiv mit der Malerei. Während des Ersten Weltkrieges diente er als Offizier und kam als Kriegsgefangener nach Italien. Nach Kriegsende widmete er sich ganz der Malerei. Anfangs als Schildermaler, Industriegraphiker und Zeitungszusteller tätig, besuchte er zahlreiche Kurse, um sich künstlerisch weiterzubilden. Er hatte Kontakte zu Gustav Karl Beck, Erich Mallina, George Kenner, Alexander Rothaug und den Künstlern des Hagenbunds. Stolz war auch mit dem Komponisten Josef Matthias Hauer befreundet, einem Musiker und Musiktheoretiker aus dem Umfeld von Arnold Schönberg, der unter den Nazis als entartet galt. Im Schaffen von Stolz finden sich Einflüsse von Jugendstil (Gustav Klimt, Carl Moll, Koloman Moser, Otto Wagner, Joseph Maria Olbrich, Josef Hoffmann, Art Déco (Wiener Werkstätte), Neuer Sachlichkeit (Carry Hauser, Franz Lerch, Sergius Pauser, Franz August Sedlacek, Ferdinand Bruckner, Robert Musil, Franz Nabl, Robert Michel, Robert Neumann, Joseph Roth), Symbolismus (Léon-François Comerre, Eugen Bracht, Arnold Böcklin, Edward Burne-Jones, Pierre Puvis de Chavannes, Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, Lovis Corinth, Henry Cros, Tivadar Kosztka Csontváry, Jean Dampt, Jean Delville, Maurice Denis, Francisco Durrio de Madrón, James Ensor, Johann Heinrich Füssli, Akseli Gallen-Kallela, Paul Gauguin, Isobel Lilian Gloag, Henry de Groux, Vilhelm Hammershøi, Per Hasselberg, Dora Hitz, Ferdinand Hodler, Ludwig von Hofmann, Wjatscheslaw Iwanowitsch Iwanow, Rudolf Jettmar, Fernand Khnopff, Max Klinger, Georges Lacombe, Franz von Lenbach, Sigmund Lipinsky, Frances MacDonald McNair, Josef Madlener, Jacek Malczewski, George Minne, Gustave Moreau, Edvard Munch, Michail Wassiljewitsch Nesterow, Max Nonnenbruch, Odilon Redon, Auguste Rodin, Félicien Rops, Sascha Schneider, Giovanni Segantini, Leon Spilliaert, Franz von Stuck, Per Adolf Svedlund, Jan Toorop, Adolfo Wildt, Jens Ferdinand Willumsen, Michail Alexandrowitsch Wrubel) und Surrealismus (André Breton, Louis Aragon, Philippe Soupault, René Magritte, Salvador Dalí, Joan Miró, Frida Kahlo). Stolz war ebenso der Anthroposphie zugeneigt wie seine Zeitgenossin und Künstlerkollegin Gertraud Reinberger-Brausewetter.Bitte beachten: Der Kaufpreis besteht aus Meistbot zuzüglich des Aufgeldes, der Umsatzsteuer sowie gegebenenfalls der Folgerechtsabgabe. Bei Normalbesteuerung (mit ° beim Schätzpreis gekennzeichnet) kommt auf das Meistbot ein Aufgeld in der Höhe von 24% hinzu. Auf die Summe von Meistbot und Aufgeld kommt die gesetzliche Umsatzsteuer hinzu. Diese beträgt 13% bei Gemälden, Aquarellen, Zeichnungen, Grafiken sowie Skulpturen und 20% bei Fotografien und allen anderen Objekten. Bei Differenzbesteuerung beträgt das Aufgeld 28%. Die Umsatzsteuer ist bei der Differenzbesteuerung inkludiert.
ALBERT REUSS* (Wien 1889 - Mousehole, Cornwall)Strandgut, 1969Öl/Leinwand/Karton 18,7 x 23,8 cmmonogrammiert AR, datiert 69SCHÄTZPREIS / ESTIMATE °€ 250 - 500STARTPREIS / STARTING PRICE °€ 250Österreichischer Maler und Bildhauer des 20. Jahrhunderts. Vertreter der Exilkunst, gehört zur sog. verschollenen oder vergessenen Generation. Stammte aus einer jüdischen Familie und arbeitete zunächst als Schauspieler. Als Maler Autodidakt, stellte ab den 1920er Jahren in der Wiener Secession, im Hagenbund und in der Galerie Würthle aus. Ab 1932 Mitglied im Hagenbund. Ab Mitte der 1930er Jahre auch Bildhauer, 1935 Aufenthalt auf Gut Bedfordshire in England. 1938 Emigration über London nach Mousehole in Cornwall. Seine Frau führte die Galerie ARRA Gallery mit Künstlern wie Jack Pender oder Alexander Mackenzie der Künstlerkolonie St. Ives. Lebenslange Freundschaft mit dem Galeristen Jacques O´Hana. Frühe Einflüsse von Gustav Klimt und Egon Schiele, danach Einflüsse der expressiven Kärntner Malerei. Nach der Emigration Stilentwicklung in Richtung Neue Sachlichkeit und Surrealismus. Landschaften mit Figuren und einzelnen Objekten in zunehmend kühlen und zurückhaltenden Farben und monochromen Flächen. Farbigkeit, Rätselhaftigkeit und die statische, frontale Haltung des weiblichen Torso vergleichbar mit Arbeiten von Paul Delvaux. Komposition und Stimmung, Ruhe, Melancholie und Kontemplation vergleichbar ähnlich in den Werken Josef Floch.Bitte beachten: Der Kaufpreis besteht aus Meistbot zuzüglich des Aufgeldes, der Umsatzsteuer sowie gegebenenfalls der Folgerechtsabgabe. Bei Normalbesteuerung (mit ° beim Schätzpreis gekennzeichnet) kommt auf das Meistbot ein Aufgeld in der Höhe von 24% hinzu. Auf die Summe von Meistbot und Aufgeld kommt die gesetzliche Umsatzsteuer hinzu. Diese beträgt 13% bei Gemälden, Aquarellen, Zeichnungen, Grafiken sowie Skulpturen und 20% bei Fotografien und allen anderen Objekten. Bei Differenzbesteuerung beträgt das Aufgeld 28%. Die Umsatzsteuer ist bei der Differenzbesteuerung inkludiert.
VERSCHIEDENE KÜNSTLERINNEN UND KÜNSTLER (Zweite Hälfte 19. Jhr. - erste Hälfte 20. Jhr.)Konvolut VER SACRUM Kompletter Jahrgang, 1898 Organ der Vereinigung Bildender Künstler Österreichs, Erster Jahrgang, 12 Hefte. Wien, Gerlach & Schnek 1898. Original Hefte mit Original Umschlägen und Original Deckelmappe. Vollständiger erster Jahrgang mit Sonderheft Heft 1 mit rotem Farbschnitt; Heft 11 mit Umschlagentwurf von Alfons Mucha und Plakatentwurf von Alfred Roller. Heft 7 mit Beitrag von Adolf Loos: Die Potemkin'sche Stadt. Heft 2 enthält die farbigen Lithografien von Kolo Moser für Gerlach und die farbige Abbildung Gustav Klimts: Die Hexe. Mit der sehr seltenen, originalen Deckelmappe. Schließbändchen nicht vorhanden. Einzelne Heftrücken teilweise kleinstellig rissig, Hefte sehr sauber und in gutem Zustand. Ver Sacrum Sammlung 1898 Jeweils 31 x 29,8 cm Kartonbindung, stark abgenutzt und gerissen 1. Heft: Ver Sacrum Sonderheft, leicht abgenutzt 2. Heft: Ver Sacrum Januar 1898, Jahrgang 1, Heft 1, am Rücken eingerissen 3. Heft: Ver Sacrum Februar 1898, Jahrgang 1, Heft 2, am Rücken eingerissen, leicht abgenutzt 4. Heft: Ver Sacrum Maerz 1898, Jahrgang 1, Heft 3, leicht abgenutzt 5. Heft: Ver Sacrum April 1898, Jahrgang 1, Heft 4, leicht abgenutzt 6. Heft: Ver Sacrum Mai – Juni 1898, Jahrgang 1, Heft 5/6, am Rücken eingerissen, vergilbt, Doppelheft 7. Heft: Ver Sacrum Juli 1898, Jahrgang 1, Heft 7, am Rücken eingerissen, abgenutzt, vergilbt 8. Heft: Ver Sacrum August 1898, Jahrgang 1, Heft 8, am Rücken eingerissen 9. Heft: Ver Sacrum September 1898, Jahrgang 1, Heft 9, am Rücken eingerissen 10. Heft: Ver Sacrum Oktober 1898, Jahrgang 1, Heft 10, am Rücken eingerissen, vergilbt 11. Heft: Ver Sacrum November 1898, Jahrgang 1, Heft 11, am Rücken eingerissen, vergilbt 12. Heft: Ver Sacrum Dezember 1898, Jahrgang 1, Heft 12SCHÄTZPREIS / ESTIMATE °€ 1600 - 3600STARTPREIS / STARTING PRICE °€ 1600"Ver Sacrum" (lat.: Heiliger Frühling) war eine von der Wiener Secession herausgegebene Kunst- und Literaturzeitschrift, die 1898 bis 1903 in Wien erschien. Ver Sacrum war das offizielle Organ der Vereinigung bildender Künstler Österreichs. Das erste Heft (Januar 1898) enthielt Texte von Hermann Bahr, Alfred Roller und Max Burckhard. Das Umschlagmotiv stammte vom Hauptredakteur Alfred Roller: Die Wurzeln eines blühenden Bäumchens, das im Blattwerk drei unbedruckte Wappenschilde für die Bereiche Architektur, Malerei und Skulptur trägt, sprengen die Dauben eines zu eng gewordenen hölzernen Pflanzkübels und beginnen, im Erdreich zu wurzeln (siehe Cover rechts). Frühlingsstimmung vermitteln die tanzenden oder verträumten Frauengestalten, die blühenden Bäume und die florale Ornamentik von Koloman Moser, Josef Hoffmann, Joseph Maria Olbrich, Maximilian Lenz und anderen; ebenso Gustav Klimt, der sich kurze Zeit als Buchschmuck-Künstler betätigte. Adolf Hölzel veröffentlichte seinen programmatischen Aufsatz Über Formen und Massenverteilung im Jahr 1901 im 15. Heft. Einen bedeutenden Schritt zur Ungegenständlichkeit setzte auch Ernst Stöhr, der im letzten Ver-Sacrum-Heft von 1899 die symbolistische Komponente vertrat. Ab 1900 trat der Informationswert stärker in den Vordergrund. Ab dem dritten Jahrgang erschien die Zeitschrift zweimal anstatt einmal im Monat, jedoch in kleinerer Auflage. Mit der Ankündigung einer „zwanglosen Folge von Veröffentlichungen“ und einem Rückblick auf die sechsjährige Editionsgeschichte wurde die regelmäßige Veröffentlichung, nachdem sie „ihren Zweck erfüllt“ hatte, Ende 1903 eingestellt.Bitte beachten: Der Kaufpreis besteht aus Meistbot zuzüglich des Aufgeldes, der Umsatzsteuer sowie gegebenenfalls der Folgerechtsabgabe. Bei Normalbesteuerung (mit ° beim Schätzpreis gekennzeichnet) kommt auf das Meistbot ein Aufgeld in der Höhe von 24% hinzu. Auf die Summe von Meistbot und Aufgeld kommt die gesetzliche Umsatzsteuer hinzu. Diese beträgt 13% bei Gemälden, Aquarellen, Zeichnungen, Grafiken sowie Skulpturen und 20% bei Fotografien und allen anderen Objekten. Bei Differenzbesteuerung beträgt das Aufgeld 28%. Die Umsatzsteuer ist bei der Differenzbesteuerung inkludiert.
FELIX ALBRECHT HARTA* (Budapest 1884 - 1967 Salzburg)Winterliche Dorflandschaft, 1918Kohle und Pastell/Papier 30 x 44 cmsigniert Harta , datiert 6 II 1918SCHÄTZPREIS / ESTIMATE € 500 - 1000STARTPREIS / STARTING PRICE € 500Der österreichische Maler Felix Albert Harta studierte an der Technischen Hochschule Wien Architektur. 1905 ging er nach München und wechselte zur Malerei. Sein Lehrer an der Akademie war Hugo von Habermann. Er begab sich auf Studienreisen nach Frankreich, Belgien, Spanien und Italien und stellte 1908 im Salon d’automne aus. Danach lebte Harta in Wien und nahm am Ersten Weltkrieg als Freiwilliger teil. Gustav Klimt riet ihm, sich als Kriegsmaler beim k.u.k. Kriegspressequartier zu bewerben. Im April 1917 wurde er dort Mitglieder der Kunstgruppe; Einsätze an der russischen und der italienischen Front. Nach Kriegsende hielt er sich bis 1923 in Salzburg auf, wo er 1919 mit Anton Faistauer die Künstlervereinigung „Der Wassermann“ gründete und deren Präsident wurde. Harta an der Gründung der Salzburger Festspiele mit beteiligt. 1921 erhielt er die Große Silberne Staatsmedaille. 1926/27 reiste er nach Paris und erhielt das Ehrendiplom der Internationalen Ausstellung in Bordeaux. Weitere Ehrungen: 1929 Österreichischer Staatspreis und 1934 Ehrenpreis der Stadt Wien. 1928 bis 1935 war Harta Mitglied im Hagenbund. 1939 bis 1950 war Harta im Exil nach England, wo er an einem College unterrichtete. Danach zog er nach Salzburg. Gusti Wolf wuchs zeitweise bei Felix Albrecht Harta und seiner Famile auf. Hartas Tochter Eva Wick lebte als Grafikerin in den USA. Harta war in frühen Jahren mit den Oskar Kokoschka, Egon Schiele und Albert Paris Gütersloh bekannt und stand dem Expressionismus nahe. Er war mit Gustav Klimt befreundet. Hartas spätere Werke, weisen in Richtung des Nachimpressionismus. Seine Themen waren vor allem Landschaft und Stillleben, Porträt und Genre.Bitte beachten: Der Kaufpreis besteht aus Meistbot zuzüglich des Aufgeldes, der Umsatzsteuer sowie gegebenenfalls der Folgerechtsabgabe. Bei Normalbesteuerung (mit ° beim Schätzpreis gekennzeichnet) kommt auf das Meistbot ein Aufgeld in der Höhe von 24% hinzu. Auf die Summe von Meistbot und Aufgeld kommt die gesetzliche Umsatzsteuer hinzu. Diese beträgt 13% bei Gemälden, Aquarellen, Zeichnungen, Grafiken sowie Skulpturen und 20% bei Fotografien und allen anderen Objekten. Bei Differenzbesteuerung beträgt das Aufgeld 28%. Die Umsatzsteuer ist bei der Differenzbesteuerung inkludiert.
EMILIE MEDIZ-PELIKAN (Vöcklabruck 1861 - 1908 Dresden)Frühling, 1898Lithografie, handkoloriert/Papier 55 x 39 cmsigniert E. Pelikan, datiert 1898montiert auf KartonBlattmaß 65,4 x 48,5 cmSCHÄTZPREIS / ESTIMATE °€ 200 - 400STARTPREIS / STARTING PRICE °€ 200Österreichische Landschaftsmalerin. Hielt sich in der Künstlerkolonie Dachau und der Künstlerkolonie Knokke auf, stellte in der Wiener Secession und im Hagenbund aus. War verheiratet mit Karl Mediz. Die Küstlerin Gertrude Hnzatko-Mediz war eine Tochter des Paares. Stilistisch ist Mediz-Pelikan einzuordnen zwischen Jugendstil, Symbolismus, Stimmungsimpressionismus und Impressionismus. Schuf Zeichnungen und Druckgrafik mit Landschaften wie die Birken von Gustav Klimt. Gehört zu den bedeutenden österreichischen Künstlerinnen wie Tina Blau, Olga Wisinger-Florian und Marie Egner. Im Gesamtœuvre der in Vöcklabruck gebürtigen Künstlerin Emilie Mediz-Pelikan, nehmen Landschaften eine zentrale Stellung ein. Sie wurde mit 21 die letzte Privatschülerin des bereits hochbetagten Landschaftsmalers Albert Zimmermann. Mediz-Pelikan studierte an der Wiener Akademie und folgte Albert Zimmermann nach Salzburg und München. 1891 heiratete sie den Maler und Grafiker Karl Mediz, mit dem sie zuerst in Wien und ab 1894 in Dresden lebte. Sie stand in Kontakt zur Dachauer Künstlerkolonie und unternahm Studienreisen nach Paris, Belgien, Ungarn und Italien. Erst um 1900 gelang ihr mit ihren Landschaftsbildern der künstlerische Durchbruch. Da der Nachlass der 1908 in Dresden frühzeitig verstorbenen Künstlerin bis in die 1980er Jahre in der DDR gelagert war, kam es erst relativ spät zur Neuentdeckung und Wiederbewertung der Künstlerin, sowohl in der österreichischen Kunstgeschichte als auch am Kunstmarkt. 1986 kam es zu ersten großen Ausstellungen im Oberösterreichischen Landesmuseum und in der Hochschule für angewandte Kunst in Wien. Wie viele impressionistische Malerinnen setzte sich Emilie Mediz-Pelikan von Beginn ihrer künstlerischen Tätigkeit an intensiv mit der Natur und deren Veränderlichkeit auseinander. Oft sind ihre Werke in eine entrückte Atmosphäre eingetaucht. Das von ihr – und von ihrem Mann – oft verwendete Motiv der Birken findet sich später auch in Darstellungen bei Klimt, Baar oder Junk wieder. In einem Brief an ihren Mann aus dem Jahr 1893 beschreibt sie ihre Reise ins böhmische Chotěboř sowie die Schönheit der Bäume in dieser Gegend. Beim Durchblättern der Korrespondenz zwischen dem Ehepaar wird die zentrale Bedeutung der Natur sofort spürbar. Ausführlich sind die Beschreibungen der Landschaft und ihrer Vegetation, die Mediz-Pelikan auch detailreich in Skizzen festhielt. Eindrucksvolle Arbeiten entstanden auch bei Reisen ans Adriatische Meer, an Küstenorten wie Duino oder Dubrovnik (Lacroma).Bitte beachten: Der Kaufpreis besteht aus Meistbot zuzüglich des Aufgeldes, der Umsatzsteuer sowie gegebenenfalls der Folgerechtsabgabe. Bei Normalbesteuerung (mit ° beim Schätzpreis gekennzeichnet) kommt auf das Meistbot ein Aufgeld in der Höhe von 24% hinzu. Auf die Summe von Meistbot und Aufgeld kommt die gesetzliche Umsatzsteuer hinzu. Diese beträgt 13% bei Gemälden, Aquarellen, Zeichnungen, Grafiken sowie Skulpturen und 20% bei Fotografien und allen anderen Objekten. Bei Differenzbesteuerung beträgt das Aufgeld 28%. Die Umsatzsteuer ist bei der Differenzbesteuerung inkludiert.
JOSEF HOFFMANN* (Pirnitz 1870 - 1956 Wien)Karaffe und TrinkglasTusche und Bleistift/Papier 16,7 x 25,8 cmverso Atelierstempel Josef HoffmannSCHÄTZPREIS / ESTIMATE °€ 400 - 800STARTPREIS / STARTING PRICE °€ 400Josef Hoffmann, Schüler von Otto Wagner, war als Architekt und Gestalter eine der zentralen Figuren der Wiener Moderne. 1903 gründete er mit Koloman Moser und dem Industrielle Fritz Waerndorfer die Wiener Werkstätte (WW), nach dem Vorbild der britischen Arts and Crafts Movement und unter dem Eindruck des Wiener Jugendstils. Hoffmann, befreundet u. a. mit Gustav Klimt und Anton Hanak, blieb bis zum Konkurs 1932 einer der wichtigsten Gestalter der WW. Die Wiener Werkstätte, bezeichnet auch als Wiener Werkstatt, Vienna Workshop, Wiener Werkstaetten oder Wiener Werkstätten, hatte die Zielsetzung, die gesamten Lebensbereiche des Menschen gestalterisch zu vereinen, im Sinne eines Gesamtkunstwerks. Zu den Kunden zählten hauptsächlich Künstler und die aufstrebende jüdische Ober- und Mittelschicht. Die Bekanntschaft Josef Hoffmanns mit Berta Zuckerkandl führte zum ersten großen Auftrag: dem Sanatorium Purkersdorf, von Viktor Zuckerkandl, Bertas Schwager, westlich von Wien geplant. Unter den Mitarbeitern der WW war auch rund ein Dutzend Frauen, die entscheidend für den Stilwandel vom Jugendstil zum Art Déco der 20er-Jahre waren, z. B. Vally Wieselthier, Gudrun Baudisch, Reni Schaschl, Hilda Jesser und Susi Singer. Die NS-Zeit überstand Josef Hoffmann trotz Anfeindungen des NS-Architekturideologen Paul Schmitthenner unbeschadet. Von der Reichskammer der bildenden Künste wurde er beauftragt, als künstlerischer Leiter den Wiener Kunsthandwerksverein (eine NS-Nachfolgeorganisation des Österreichischen Werkbundes) weiterzuentwickeln. Zu diesem Zweck wurde 1941 eine „künstlerische Versuchsanstalt“ gegründet, in der junge Kunsthandwerker sich unter Hoffmanns Anleitung weiterbilden konnten. Nach dem Krieg, 1948, gründete Hoffmann die Österreichischen Werkstätten als Nachfolgerin von Wiener Werkstätte und Werkbund (ÖWB), dem er bis 1920 angehört hatte. Hoffmanns Grabstein wurde von Fritz Wotruba gestaltet.Bitte beachten: Der Kaufpreis besteht aus Meistbot zuzüglich des Aufgeldes, der Umsatzsteuer sowie gegebenenfalls der Folgerechtsabgabe. Bei Normalbesteuerung (mit ° beim Schätzpreis gekennzeichnet) kommt auf das Meistbot ein Aufgeld in der Höhe von 24% hinzu. Auf die Summe von Meistbot und Aufgeld kommt die gesetzliche Umsatzsteuer hinzu. Diese beträgt 13% bei Gemälden, Aquarellen, Zeichnungen, Grafiken sowie Skulpturen und 20% bei Fotografien und allen anderen Objekten. Bei Differenzbesteuerung beträgt das Aufgeld 28%. Die Umsatzsteuer ist bei der Differenzbesteuerung inkludiert.
JOSEF HOFFMANN* (Pirnitz 1870 - 1956 Wien)Vase mit floralem DekorBleistift/Papier 29,6 x 20,9 cmmonogrammiert JHverso nummeriert 10SCHÄTZPREIS / ESTIMATE °€ 250 - 500STARTPREIS / STARTING PRICE °€ 250Josef Hoffmann, Schüler von Otto Wagner, war als Architekt und Gestalter eine der zentralen Figuren der Wiener Moderne. 1903 gründete er mit Koloman Moser und dem Industrielle Fritz Waerndorfer die Wiener Werkstätte (WW), nach dem Vorbild der britischen Arts and Crafts Movement und unter dem Eindruck des Wiener Jugendstils. Hoffmann, befreundet u. a. mit Gustav Klimt und Anton Hanak, blieb bis zum Konkurs 1932 einer der wichtigsten Gestalter der WW. Die Wiener Werkstätte, bezeichnet auch als Wiener Werkstatt, Vienna Workshop, Wiener Werkstaetten oder Wiener Werkstätten, hatte die Zielsetzung, die gesamten Lebensbereiche des Menschen gestalterisch zu vereinen, im Sinne eines Gesamtkunstwerks. Zu den Kunden zählten hauptsächlich Künstler und die aufstrebende jüdische Ober- und Mittelschicht. Die Bekanntschaft Josef Hoffmanns mit Berta Zuckerkandl führte zum ersten großen Auftrag: dem Sanatorium Purkersdorf, von Viktor Zuckerkandl, Bertas Schwager, westlich von Wien geplant. Unter den Mitarbeitern der WW war auch rund ein Dutzend Frauen, die entscheidend für den Stilwandel vom Jugendstil zum Art Déco der 20er-Jahre waren, z. B. Vally Wieselthier, Gudrun Baudisch, Reni Schaschl, Hilda Jesser und Susi Singer. Die NS-Zeit überstand Josef Hoffmann trotz Anfeindungen des NS-Architekturideologen Paul Schmitthenner unbeschadet. Von der Reichskammer der bildenden Künste wurde er beauftragt, als künstlerischer Leiter den Wiener Kunsthandwerksverein (eine NS-Nachfolgeorganisation des Österreichischen Werkbundes) weiterzuentwickeln. Zu diesem Zweck wurde 1941 eine „künstlerische Versuchsanstalt“ gegründet, in der junge Kunsthandwerker sich unter Hoffmanns Anleitung weiterbilden konnten. Nach dem Krieg, 1948, gründete Hoffmann die Österreichischen Werkstätten als Nachfolgerin von Wiener Werkstätte und Werkbund (ÖWB), dem er bis 1920 angehört hatte. Hoffmanns Grabstein wurde von Fritz Wotruba gestaltet.Bitte beachten: Der Kaufpreis besteht aus Meistbot zuzüglich des Aufgeldes, der Umsatzsteuer sowie gegebenenfalls der Folgerechtsabgabe. Bei Normalbesteuerung (mit ° beim Schätzpreis gekennzeichnet) kommt auf das Meistbot ein Aufgeld in der Höhe von 24% hinzu. Auf die Summe von Meistbot und Aufgeld kommt die gesetzliche Umsatzsteuer hinzu. Diese beträgt 13% bei Gemälden, Aquarellen, Zeichnungen, Grafiken sowie Skulpturen und 20% bei Fotografien und allen anderen Objekten. Bei Differenzbesteuerung beträgt das Aufgeld 28%. Die Umsatzsteuer ist bei der Differenzbesteuerung inkludiert.
UNBEKANNTE FOTOGRAFIN/ UNBEKANNTER FOTOGRAF (Lebensdaten unbekannt)Palais Stoclet, um 1911Vintage Fotografie 36,7 x 49,8 cmerbaut 1905 - 1911verso Atelierstempel Josef Hoffmann und beschriftet Brüssel 1905 Haus Stocletaus dem Nachlass von Karla HoffmannSCHÄTZPREIS / ESTIMATE °€ 300 - 600STARTPREIS / STARTING PRICE °€ 300Josef Hoffmann, Schüler von Otto Wagner, war als Architekt und Gestalter eine der zentralen Figuren der Wiener Moderne. 1903 gründete er mit Koloman Moser und dem Industrielle Fritz Waerndorfer die Wiener Werkstätte (WW), nach dem Vorbild der britischen Arts and Crafts Movement und unter dem Eindruck des Wiener Jugendstils. Hoffmann, befreundet u. a. mit Gustav Klimt und Anton Hanak, blieb bis zum Konkurs 1932 einer der wichtigsten Gestalter der WW. Die Wiener Werkstätte, bezeichnet auch als Wiener Werkstatt, Vienna Workshop, Wiener Werkstaetten oder Wiener Werkstätten, hatte die Zielsetzung, die gesamten Lebensbereiche des Menschen gestalterisch zu vereinen, im Sinne eines Gesamtkunstwerks. Zu den Kunden zählten hauptsächlich Künstler und die aufstrebende jüdische Ober- und Mittelschicht. Die Bekanntschaft Josef Hoffmanns mit Berta Zuckerkandl führte zum ersten großen Auftrag: dem Sanatorium Purkersdorf, von Viktor Zuckerkandl, Bertas Schwager, westlich von Wien geplant. Unter den Mitarbeitern der WW war auch rund ein Dutzend Frauen, die entscheidend für den Stilwandel vom Jugendstil zum Art Déco der 20er-Jahre waren, z. B. Vally Wieselthier, Gudrun Baudisch, Reni Schaschl, Hilda Jesser und Susi Singer. Die NS-Zeit überstand Josef Hoffmann trotz Anfeindungen des NS-Architekturideologen Paul Schmitthenner unbeschadet. Von der Reichskammer der bildenden Künste wurde er beauftragt, als künstlerischer Leiter den Wiener Kunsthandwerksverein (eine NS-Nachfolgeorganisation des Österreichischen Werkbundes) weiterzuentwickeln. Zu diesem Zweck wurde 1941 eine „künstlerische Versuchsanstalt“ gegründet, in der junge Kunsthandwerker sich unter Hoffmanns Anleitung weiterbilden konnten. Nach dem Krieg, 1948, gründete Hoffmann die Österreichischen Werkstätten als Nachfolgerin von Wiener Werkstätte und Werkbund (ÖWB), dem er bis 1920 angehört hatte. Hoffmanns Grabstein wurde von Fritz Wotruba gestaltet.Bitte beachten: Der Kaufpreis besteht aus Meistbot zuzüglich des Aufgeldes, der Umsatzsteuer sowie gegebenenfalls der Folgerechtsabgabe. Bei Normalbesteuerung (mit ° beim Schätzpreis gekennzeichnet) kommt auf das Meistbot ein Aufgeld in der Höhe von 24% hinzu. Auf die Summe von Meistbot und Aufgeld kommt die gesetzliche Umsatzsteuer hinzu. Diese beträgt 13% bei Gemälden, Aquarellen, Zeichnungen, Grafiken sowie Skulpturen und 20% bei Fotografien und allen anderen Objekten. Bei Differenzbesteuerung beträgt das Aufgeld 28%. Die Umsatzsteuer ist bei der Differenzbesteuerung inkludiert.
ERWIN STOLZ* (Gießhübl-Sauerbrunn 1896 - 1987 Wien)Argonauten, 1924Mischtechnik/Papier 43,5 x 26 cmsigniert Erwin Stolz, datiert 24SCHÄTZPREIS / ESTIMATE °€ 1200 - 2400STARTPREIS / STARTING PRICE °€ 1200Der österreichische Künstler Erwin Stolz erhielt eine Ausbildung zum Agraringenieur, doch in seiner Freizeit beschäftigte er sich intensiv mit der Malerei. Während des Ersten Weltkrieges diente er als Offizier und kam als Kriegsgefangener nach Italien. Nach Kriegsende widmete er sich ganz der Malerei. Anfangs als Schildermaler, Industriegraphiker und Zeitungszusteller tätig, besuchte er zahlreiche Kurse, um sich künstlerisch weiterzubilden. Er hatte Kontakte zu Gustav Karl Beck, Erich Mallina, George Kenner, Alexander Rothaug und den Künstlern des Hagenbunds. Stolz war auch mit dem Komponisten Josef Matthias Hauer befreundet, einem Musiker und Musiktheoretiker aus dem Umfeld von Arnold Schönberg, der unter den Nazis als entartet galt. Im Schaffen von Stolz finden sich Einflüsse von Jugendstil (Gustav Klimt, Carl Moll, Koloman Moser, Otto Wagner, Joseph Maria Olbrich, Josef Hoffmann, Art Déco (Wiener Werkstätte), Neuer Sachlichkeit (Carry Hauser, Franz Lerch, Sergius Pauser, Franz August Sedlacek, Ferdinand Bruckner, Robert Musil, Franz Nabl, Robert Michel, Robert Neumann, Joseph Roth), Symbolismus (Léon-François Comerre, Eugen Bracht, Arnold Böcklin, Edward Burne-Jones, Pierre Puvis de Chavannes, Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, Lovis Corinth, Henry Cros, Tivadar Kosztka Csontváry, Jean Dampt, Jean Delville, Maurice Denis, Francisco Durrio de Madrón, James Ensor, Johann Heinrich Füssli, Akseli Gallen-Kallela, Paul Gauguin, Isobel Lilian Gloag, Henry de Groux, Vilhelm Hammershøi, Per Hasselberg, Dora Hitz, Ferdinand Hodler, Ludwig von Hofmann, Wjatscheslaw Iwanowitsch Iwanow, Rudolf Jettmar, Fernand Khnopff, Max Klinger, Georges Lacombe, Franz von Lenbach, Sigmund Lipinsky, Frances MacDonald McNair, Josef Madlener, Jacek Malczewski, George Minne, Gustave Moreau, Edvard Munch, Michail Wassiljewitsch Nesterow, Max Nonnenbruch, Odilon Redon, Auguste Rodin, Félicien Rops, Sascha Schneider, Giovanni Segantini, Leon Spilliaert, Franz von Stuck, Per Adolf Svedlund, Jan Toorop, Adolfo Wildt, Jens Ferdinand Willumsen, Michail Alexandrowitsch Wrubel) und Surrealismus (André Breton, Louis Aragon, Philippe Soupault, René Magritte, Salvador Dalí, Joan Miró, Frida Kahlo). Stolz war ebenso der Anthroposphie zugeneigt wie seine Zeitgenossin und Künstlerkollegin Gertraud Reinberger-Brausewetter.Bitte beachten: Der Kaufpreis besteht aus Meistbot zuzüglich des Aufgeldes, der Umsatzsteuer sowie gegebenenfalls der Folgerechtsabgabe. Bei Normalbesteuerung (mit ° beim Schätzpreis gekennzeichnet) kommt auf das Meistbot ein Aufgeld in der Höhe von 24% hinzu. Auf die Summe von Meistbot und Aufgeld kommt die gesetzliche Umsatzsteuer hinzu. Diese beträgt 13% bei Gemälden, Aquarellen, Zeichnungen, Grafiken sowie Skulpturen und 20% bei Fotografien und allen anderen Objekten. Bei Differenzbesteuerung beträgt das Aufgeld 28%. Die Umsatzsteuer ist bei der Differenzbesteuerung inkludiert.
JOSEF HOFFMANN* (Pirnitz 1870 - 1956 Wien)Entwurf städtisches WohnhausTusche und Bleistift/Papier 29,6 x 41,8 cmmonogrammiert JHAtelierstempel Josef Hoffmannabgebildet im Ausstellungskatalog Josef Hoffmann 1870-1956. Fortschritt durch Schönheit, MAK, Wien 2021, S. 288, Abb. 22Beigaben: 1 Silbergelatineabzug/Papier, Wohnhausanlage der Gemeinde Wien, Klosehof 1923-25, abgebildet im Josef Hoffmann 1870-1956. Fortschritt durch Schönheit, MAK, Wien 2021, S. 311 1 Silbergelatineabzug/Papier eines unidentifizierten Portales, 2 Kopien und ein Zeitungsausschnitt über Portalskulptur Klosehof bzw. Wohnhaus Felix MottlstraßeSCHÄTZPREIS / ESTIMATE °€ 1000 - 2000STARTPREIS / STARTING PRICE °€ 1000Josef Hoffmann, Schüler von Otto Wagner, war als Architekt und Gestalter eine der zentralen Figuren der Wiener Moderne. 1903 gründete er mit Koloman Moser und dem Industrielle Fritz Waerndorfer die Wiener Werkstätte (WW), nach dem Vorbild der britischen Arts and Crafts Movement und unter dem Eindruck des Wiener Jugendstils. Hoffmann, befreundet u. a. mit Gustav Klimt und Anton Hanak, blieb bis zum Konkurs 1932 einer der wichtigsten Gestalter der WW. Die Wiener Werkstätte, bezeichnet auch als Wiener Werkstatt, Vienna Workshop, Wiener Werkstaetten oder Wiener Werkstätten, hatte die Zielsetzung, die gesamten Lebensbereiche des Menschen gestalterisch zu vereinen, im Sinne eines Gesamtkunstwerks. Zu den Kunden zählten hauptsächlich Künstler und die aufstrebende jüdische Ober- und Mittelschicht. Die Bekanntschaft Josef Hoffmanns mit Berta Zuckerkandl führte zum ersten großen Auftrag: dem Sanatorium Purkersdorf, von Viktor Zuckerkandl, Bertas Schwager, westlich von Wien geplant. Unter den Mitarbeitern der WW war auch rund ein Dutzend Frauen, die entscheidend für den Stilwandel vom Jugendstil zum Art Déco der 20er-Jahre waren, z. B. Vally Wieselthier, Gudrun Baudisch, Reni Schaschl, Hilda Jesser und Susi Singer. Die NS-Zeit überstand Josef Hoffmann trotz Anfeindungen des NS-Architekturideologen Paul Schmitthenner unbeschadet. Von der Reichskammer der bildenden Künste wurde er beauftragt, als künstlerischer Leiter den Wiener Kunsthandwerksverein (eine NS-Nachfolgeorganisation des Österreichischen Werkbundes) weiterzuentwickeln. Zu diesem Zweck wurde 1941 eine „künstlerische Versuchsanstalt“ gegründet, in der junge Kunsthandwerker sich unter Hoffmanns Anleitung weiterbilden konnten. Nach dem Krieg, 1948, gründete Hoffmann die Österreichischen Werkstätten als Nachfolgerin von Wiener Werkstätte und Werkbund (ÖWB), dem er bis 1920 angehört hatte. Hoffmanns Grabstein wurde von Fritz Wotruba gestaltet.Bitte beachten: Der Kaufpreis besteht aus Meistbot zuzüglich des Aufgeldes, der Umsatzsteuer sowie gegebenenfalls der Folgerechtsabgabe. Bei Normalbesteuerung (mit ° beim Schätzpreis gekennzeichnet) kommt auf das Meistbot ein Aufgeld in der Höhe von 24% hinzu. Auf die Summe von Meistbot und Aufgeld kommt die gesetzliche Umsatzsteuer hinzu. Diese beträgt 13% bei Gemälden, Aquarellen, Zeichnungen, Grafiken sowie Skulpturen und 20% bei Fotografien und allen anderen Objekten. Bei Differenzbesteuerung beträgt das Aufgeld 28%. Die Umsatzsteuer ist bei der Differenzbesteuerung inkludiert.
JOSEF HOFFMANN* (Pirnitz 1870 - 1956 Wien)PokalentwurfBleistift und Tusche/Papier 22,2 x 16,3 cmbeschriftet 12, verso Atelierstempel Josef Hoffmann und beschriftet N. 26montiert auf KartonSCHÄTZPREIS / ESTIMATE °€ 400 - 800STARTPREIS / STARTING PRICE °€ 400Josef Hoffmann, Schüler von Otto Wagner, war als Architekt und Gestalter eine der zentralen Figuren der Wiener Moderne. 1903 gründete er mit Koloman Moser und dem Industrielle Fritz Waerndorfer die Wiener Werkstätte (WW), nach dem Vorbild der britischen Arts and Crafts Movement und unter dem Eindruck des Wiener Jugendstils. Hoffmann, befreundet u. a. mit Gustav Klimt und Anton Hanak, blieb bis zum Konkurs 1932 einer der wichtigsten Gestalter der WW. Die Wiener Werkstätte, bezeichnet auch als Wiener Werkstatt, Vienna Workshop, Wiener Werkstaetten oder Wiener Werkstätten, hatte die Zielsetzung, die gesamten Lebensbereiche des Menschen gestalterisch zu vereinen, im Sinne eines Gesamtkunstwerks. Zu den Kunden zählten hauptsächlich Künstler und die aufstrebende jüdische Ober- und Mittelschicht. Die Bekanntschaft Josef Hoffmanns mit Berta Zuckerkandl führte zum ersten großen Auftrag: dem Sanatorium Purkersdorf, von Viktor Zuckerkandl, Bertas Schwager, westlich von Wien geplant. Unter den Mitarbeitern der WW war auch rund ein Dutzend Frauen, die entscheidend für den Stilwandel vom Jugendstil zum Art Déco der 20er-Jahre waren, z. B. Vally Wieselthier, Gudrun Baudisch, Reni Schaschl, Hilda Jesser und Susi Singer. Die NS-Zeit überstand Josef Hoffmann trotz Anfeindungen des NS-Architekturideologen Paul Schmitthenner unbeschadet. Von der Reichskammer der bildenden Künste wurde er beauftragt, als künstlerischer Leiter den Wiener Kunsthandwerksverein (eine NS-Nachfolgeorganisation des Österreichischen Werkbundes) weiterzuentwickeln. Zu diesem Zweck wurde 1941 eine „künstlerische Versuchsanstalt“ gegründet, in der junge Kunsthandwerker sich unter Hoffmanns Anleitung weiterbilden konnten. Nach dem Krieg, 1948, gründete Hoffmann die Österreichischen Werkstätten als Nachfolgerin von Wiener Werkstätte und Werkbund (ÖWB), dem er bis 1920 angehört hatte. Hoffmanns Grabstein wurde von Fritz Wotruba gestaltet.Bitte beachten: Der Kaufpreis besteht aus Meistbot zuzüglich des Aufgeldes, der Umsatzsteuer sowie gegebenenfalls der Folgerechtsabgabe. Bei Normalbesteuerung (mit ° beim Schätzpreis gekennzeichnet) kommt auf das Meistbot ein Aufgeld in der Höhe von 24% hinzu. Auf die Summe von Meistbot und Aufgeld kommt die gesetzliche Umsatzsteuer hinzu. Diese beträgt 13% bei Gemälden, Aquarellen, Zeichnungen, Grafiken sowie Skulpturen und 20% bei Fotografien und allen anderen Objekten. Bei Differenzbesteuerung beträgt das Aufgeld 28%. Die Umsatzsteuer ist bei der Differenzbesteuerung inkludiert.
ERWIN STOLZ* (Gießhübl-Sauerbrunn 1896 - 1987 Wien)Begegnung mit einem EngelTusche/Papier 58,2 x 40,2 cmsigniert Er. StolzSCHÄTZPREIS / ESTIMATE °€ 600 - 800STARTPREIS / STARTING PRICE °€ 600Erwin Stolz erhielt eine Ausbildung zum Agraringenieur, doch in seiner Freizeit beschäftigte er sich intensiv mit der Malerei. Während des Ersten Weltkrieges diente er als Offizier und kam als Kriegsgefangener nach Italien. Nach Kriegsende widmete er sich ganz der Malerei. Anfangs als Schildermaler, Industriegraphiker und Zeitungszusteller tätig, besuchte er zahlreiche Kurse, um sich künstlerisch weiterzubilden. Er hatte Kontakte zu Gustav Karl Beck, Erich Mallina, George Kenner, Alexander Rothaug und den Künstlern des Hagenbunds. Stolz war auch mit dem Komponisten Josef Matthias Hauer befreundet, einem Musiker und Musiktheoretiker aus dem Umfeld von Arnold Schönberg, der unter den Nazis als entartet galt. Im Schaffen von Stolz finden sich Einflüsse von Jugendstil (Gustav Klimt, Carl Moll, Koloman Moser, Otto Wagner, Joseph Maria Olbrich, Josef Hoffmann, Art Déco (Wiener Werkstätte), Neuer Sachlichkeit (Carry Hauser, Franz Lerch, Sergius Pauser, Franz August Sedlacek, Ferdinand Bruckner, Robert Musil, Franz Nabl, Robert Michel, Robert Neumann, Joseph Roth), Symbolismus (Léon-François Comerre, Eugen Bracht, Arnold Böcklin, Edward Burne-Jones, Pierre Puvis de Chavannes, Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, Lovis Corinth, Henry Cros, Tivadar Kosztka Csontváry, Jean Dampt, Jean Delville, Maurice Denis, Francisco Durrio de Madrón, James Ensor, Johann Heinrich Füssli, Akseli Gallen-Kallela, Paul Gauguin, Isobel Lilian Gloag, Henry de Groux, Vilhelm Hammershøi, Per Hasselberg, Dora Hitz, Ferdinand Hodler, Ludwig von Hofmann, Wjatscheslaw Iwanowitsch Iwanow, Rudolf Jettmar, Fernand Khnopff, Max Klinger, Georges Lacombe, Franz von Lenbach, Sigmund Lipinsky, Frances MacDonald McNair, Josef Madlener, Jacek Malczewski, George Minne, Gustave Moreau, Edvard Munch, Michail Wassiljewitsch Nesterow, Max Nonnenbruch, Odilon Redon, Auguste Rodin, Félicien Rops, Sascha Schneider, Giovanni Segantini, Leon Spilliaert, Franz von Stuck, Per Adolf Svedlund, Jan Toorop, Adolfo Wildt, Jens Ferdinand Willumsen, Michail Alexandrowitsch Wrubel) und Surrealismus (André Breton, Louis Aragon, Philippe Soupault, René Magritte, Salvador Dalí, Joan Miró, Frida Kahlo). Stolz war ebenso der Anthroposphie zugeneigt wie seine Zeitgenossin und Künstlerkollegin Gertraud Reinberger-Brausewetter.Bitte beachten: Der Kaufpreis besteht aus Meistbot zuzüglich des Aufgeldes, der Umsatzsteuer sowie gegebenenfalls der Folgerechtsabgabe. Bei Normalbesteuerung (mit ° beim Schätzpreis gekennzeichnet) kommt auf das Meistbot ein Aufgeld in der Höhe von 24% hinzu. Auf die Summe von Meistbot und Aufgeld kommt die gesetzliche Umsatzsteuer hinzu. Diese beträgt 13% bei Gemälden, Aquarellen, Zeichnungen, Grafiken sowie Skulpturen und 20% bei Fotografien und allen anderen Objekten. Bei Differenzbesteuerung beträgt das Aufgeld 28%. Die Umsatzsteuer ist bei der Differenzbesteuerung inkludiert.
RICHARD TESCHNER (Karlsbad 1879 - 1948 Wien)Homunkulus, 1916Aquatinta/Papier 42,2 x 33,1 cmsigniert Richard Teschnermonogrammiert und datiert im Druck RT 16SCHÄTZPREIS / ESTIMATE °€ 300 - 600STARTPREIS / STARTING PRICE °€ 300Der österreichische Künstler Richard Teschner war ein Protagonist des Wiener Jugendstils. Stammt aus Karlsbad in Böhmen. Studierte an der Kunstakademie in Prag und der Kunstgewerbeschule in Wien. Kunsthandwerker, Puppenspieler, Mitglied der Wiener Werkstätte. Im Umfeld von Gustav Klimt, verbrachte Sommerurlaube am Attersee. Inspiriert vom javanischen Puppentheater, von Märchen und Sagen, schuf er Ölbilder und Grafik, auch Stabpuppen und Bühnendekorationen mit phantastischen Motiven und Figurenbilder wie die Ruderer. Teschner studierte zunächst an der Kunstakademie Prag und später an der Wiener Kunstgewerbeschule. Nach seiner Übersiedlung nach Wien schloss er sich der Wiener Werkstätte an. Ab 1910 gehörte er wie Gustav Klimt zu einer Gruppe von Künstlern und Kreativen, die regelmäßig als Gäste des k.u.k. Hoftischlermeisters Friedrich Paulick ihre Sommerfrische in dessen Villa am Attersee verbrachten. Dort lernte er die Tochter des Gastgebers, Emma Paulick, kennen, die er 1911 ehelichte. Diese vorteilhafte Heirat verschaffte ihm finanzielle Unabhängigkeit. Inspiriert vom javanischen Stabpuppentheater wendet er sich in der Folgezeit neben der Malerei und Grafik auch dem Puppenspiel zu und gestaltet eigene Stabpuppen und Guckkastenbühnen. Seine Malerei und Grafik ist unter anderem von Elementen aus der asiatischen Kultur sowie von Märchen und Sagen geprägt.Bitte beachten: Der Kaufpreis besteht aus Meistbot zuzüglich des Aufgeldes, der Umsatzsteuer sowie gegebenenfalls der Folgerechtsabgabe. Bei Normalbesteuerung (mit ° beim Schätzpreis gekennzeichnet) kommt auf das Meistbot ein Aufgeld in der Höhe von 24% hinzu. Auf die Summe von Meistbot und Aufgeld kommt die gesetzliche Umsatzsteuer hinzu. Diese beträgt 13% bei Gemälden, Aquarellen, Zeichnungen, Grafiken sowie Skulpturen und 20% bei Fotografien und allen anderen Objekten. Bei Differenzbesteuerung beträgt das Aufgeld 28%. Die Umsatzsteuer ist bei der Differenzbesteuerung inkludiert.
EMILIE MEDIZ-PELIKAN (Vöcklabruck 1861 - 1908 Dresden)Landschaft, 1905Buntstift/Papier 19 x 24 cmmonogrammiert E.P., datiert Juli 1905SCHÄTZPREIS / ESTIMATE °€ 300 - 600STARTPREIS / STARTING PRICE °€ 300Österreichische Landschaftsmalerin. Hielt sich in der Künstlerkolonie Dachau und der Künstlerkolonie Knokke auf, stellte in der Wiener Secession und im Hagenbund aus. War verheiratet mit Karl Mediz. Die Küstlerin Gertrude Hnzatko-Mediz war eine Tochter des Paares. Stilistisch ist Mediz-Pelikan einzuordnen zwischen Jugendstil, Symbolismus, Stimmungsimpressionismus und Impressionismus. Schuf Zeichnungen und Druckgrafik mit Landschaften wie die Birken von Gustav Klimt. Gehört zu den bedeutenden österreichischen Künstlerinnen wie Tina Blau, Olga Wisinger-Florian und Marie Egner. Im Gesamtœuvre der in Vöcklabruck gebürtigen Künstlerin Emilie Mediz-Pelikan, nehmen Landschaften eine zentrale Stellung ein. Sie wurde mit 21 die letzte Privatschülerin des bereits hochbetagten Landschaftsmalers Albert Zimmermann. Mediz-Pelikan studierte an der Wiener Akademie und folgte Albert Zimmermann nach Salzburg und München. 1891 heiratete sie den Maler und Grafiker Karl Mediz, mit dem sie zuerst in Wien und ab 1894 in Dresden lebte. Sie stand in Kontakt zur Dachauer Künstlerkolonie und unternahm Studienreisen nach Paris, Belgien, Ungarn und Italien. Erst um 1900 gelang ihr mit ihren Landschaftsbildern der künstlerische Durchbruch. Da der Nachlass der 1908 in Dresden frühzeitig verstorbenen Künstlerin bis in die 1980er Jahre in der DDR gelagert war, kam es erst relativ spät zur Neuentdeckung und Wiederbewertung der Künstlerin, sowohl in der österreichischen Kunstgeschichte als auch am Kunstmarkt. 1986 kam es zu ersten großen Ausstellungen im Oberösterreichischen Landesmuseum und in der Hochschule für angewandte Kunst in Wien. Wie viele impressionistische Malerinnen setzte sich Emilie Mediz-Pelikan von Beginn ihrer künstlerischen Tätigkeit an intensiv mit der Natur und deren Veränderlichkeit auseinander. Oft sind ihre Werke in eine entrückte Atmosphäre eingetaucht. Das von ihr – und von ihrem Mann – oft verwendete Motiv der Birken findet sich später auch in Darstellungen bei Klimt, Baar oder Junk wieder. In einem Brief an ihren Mann aus dem Jahr 1893 beschreibt sie ihre Reise ins böhmische Chotěboř sowie die Schönheit der Bäume in dieser Gegend. Beim Durchblättern der Korrespondenz zwischen dem Ehepaar wird die zentrale Bedeutung der Natur sofort spürbar. Ausführlich sind die Beschreibungen der Landschaft und ihrer Vegetation, die Mediz-Pelikan auch detailreich in Skizzen festhielt. Eindrucksvolle Arbeiten entstanden auch bei Reisen ans Adriatische Meer, an Küstenorten wie Duino oder Dubrovnik (Lacroma).Bitte beachten: Der Kaufpreis besteht aus Meistbot zuzüglich des Aufgeldes, der Umsatzsteuer sowie gegebenenfalls der Folgerechtsabgabe. Bei Normalbesteuerung (mit ° beim Schätzpreis gekennzeichnet) kommt auf das Meistbot ein Aufgeld in der Höhe von 24% hinzu. Auf die Summe von Meistbot und Aufgeld kommt die gesetzliche Umsatzsteuer hinzu. Diese beträgt 13% bei Gemälden, Aquarellen, Zeichnungen, Grafiken sowie Skulpturen und 20% bei Fotografien und allen anderen Objekten. Bei Differenzbesteuerung beträgt das Aufgeld 28%. Die Umsatzsteuer ist bei der Differenzbesteuerung inkludiert.
EGON SCHIELE (Tulln an der Donau 1890 - 1918 Wien)Bildnis Arthur Rössler, 1914Kaltnadelradierung/Papier 31,9 x 45,1 cmEdition von 1969 von Otto Kallirverso monogrammiert und datiert OK 1969, sowie nummeriert 4/80, prachtvoller DruckProvenienz Sammlung Chrastek, WienSCHÄTZPREIS / ESTIMATE € 2000 - 4000STARTPREIS / STARTING PRICE € 2000Egon Schiele begann bereits 1906, mit nur 16 Jahren, ein Studium der Malerei an der Akademie der bildenden Künste in Wien. Zwei Jahre später verließ er die Akademie, weil ihn der starre Lehrplan zu stark einschränkte und gründete die "Neukunstgruppe" (Anton Peschka Anton Faistauer, Rudolf Kalvach, Hans Böhler, Erwin Osen, Franz Wiegele, Robin Christian Andersen, Arthur Löwenstein; später auch Oskar Kokoschka, Karl Hofer, Sebastian Isepp, Albert Paris Gütersloh und Anton Kolig); im selben Jahr hatte er seine erste öffentliche Ausstellung. Frühen prägenden Einfluss hatte der Kontakt zu Gustav Klimt. Die Abkehr vom Jugenstil und zunehmende Hinwendung zu Expressionismus wurde durch die Freundschaft zu Max Oppenheimer ausgelöst. 1909 erkannte der Kunstkritiker und Publizist Arthur Roessler die Bedeutung Schieles. In der Folge rühret er für den jungen Künstler die Werbetrommel, führt ihn in die Wiener Sammlerzirkel ein und vermittelt ihm seine ersten Aufträge. Auch in Roesslers eigener Stsammlung war Schiele mit einer exzellenten Werkauswahl vertreten. 1911 lebte Schiele in Krumau und anschließend in Neulengbach. Seine Aktdarstellungen führten zu einer Verurteilung wegen der "Verbreitung unsittlicher Zeichnungen" und einem 24-tägigen Gefängnisaufenthalt im gleichen Jahr. 1912 zog Schiele wieder nach Wien. Seine Karriere entwickelte sich kontinuierlich und wurde 1918 vom frühen Tod durch eine Erkrankung an der Spanischen Grippe, der auch Schieles Frau Edith erlag, jäh unterbrochen. Bitte beachten: Der Kaufpreis besteht aus Meistbot zuzüglich des Aufgeldes, der Umsatzsteuer sowie gegebenenfalls der Folgerechtsabgabe. Bei Normalbesteuerung (mit ° beim Schätzpreis gekennzeichnet) kommt auf das Meistbot ein Aufgeld in der Höhe von 24% hinzu. Auf die Summe von Meistbot und Aufgeld kommt die gesetzliche Umsatzsteuer hinzu. Diese beträgt 13% bei Gemälden, Aquarellen, Zeichnungen, Grafiken sowie Skulpturen und 20% bei Fotografien und allen anderen Objekten. Bei Differenzbesteuerung beträgt das Aufgeld 28%. Die Umsatzsteuer ist bei der Differenzbesteuerung inkludiert.
JOSEF HOFFMANN* (Pirnitz 1870 - 1956 Wien)Entwurf TrinkgläserCollage/Papier 41,9 x 59,6 cmauf Karton montiertSCHÄTZPREIS / ESTIMATE °€ 500 - 1000STARTPREIS / STARTING PRICE °€ 500Josef Hoffmann, Schüler von Otto Wagner, war als Architekt und Gestalter eine der zentralen Figuren der Wiener Moderne. 1903 gründete er mit Koloman Moser und dem Industrielle Fritz Waerndorfer die Wiener Werkstätte (WW), nach dem Vorbild der britischen Arts and Crafts Movement und unter dem Eindruck des Wiener Jugendstils. Hoffmann, befreundet u. a. mit Gustav Klimt und Anton Hanak, blieb bis zum Konkurs 1932 einer der wichtigsten Gestalter der WW. Die Wiener Werkstätte, bezeichnet auch als Wiener Werkstatt, Vienna Workshop, Wiener Werkstaetten oder Wiener Werkstätten, hatte die Zielsetzung, die gesamten Lebensbereiche des Menschen gestalterisch zu vereinen, im Sinne eines Gesamtkunstwerks. Zu den Kunden zählten hauptsächlich Künstler und die aufstrebende jüdische Ober- und Mittelschicht. Die Bekanntschaft Josef Hoffmanns mit Berta Zuckerkandl führte zum ersten großen Auftrag: dem Sanatorium Purkersdorf, von Viktor Zuckerkandl, Bertas Schwager, westlich von Wien geplant. Unter den Mitarbeitern der WW war auch rund ein Dutzend Frauen, die entscheidend für den Stilwandel vom Jugendstil zum Art Déco der 20er-Jahre waren, z. B. Vally Wieselthier, Gudrun Baudisch, Reni Schaschl, Hilda Jesser und Susi Singer. Die NS-Zeit überstand Josef Hoffmann trotz Anfeindungen des NS-Architekturideologen Paul Schmitthenner unbeschadet. Von der Reichskammer der bildenden Künste wurde er beauftragt, als künstlerischer Leiter den Wiener Kunsthandwerksverein (eine NS-Nachfolgeorganisation des Österreichischen Werkbundes) weiterzuentwickeln. Zu diesem Zweck wurde 1941 eine „künstlerische Versuchsanstalt“ gegründet, in der junge Kunsthandwerker sich unter Hoffmanns Anleitung weiterbilden konnten. Nach dem Krieg, 1948, gründete Hoffmann die Österreichischen Werkstätten als Nachfolgerin von Wiener Werkstätte und Werkbund (ÖWB), dem er bis 1920 angehört hatte. Hoffmanns Grabstein wurde von Fritz Wotruba gestaltet.Bitte beachten: Der Kaufpreis besteht aus Meistbot zuzüglich des Aufgeldes, der Umsatzsteuer sowie gegebenenfalls der Folgerechtsabgabe. Bei Normalbesteuerung (mit ° beim Schätzpreis gekennzeichnet) kommt auf das Meistbot ein Aufgeld in der Höhe von 24% hinzu. Auf die Summe von Meistbot und Aufgeld kommt die gesetzliche Umsatzsteuer hinzu. Diese beträgt 13% bei Gemälden, Aquarellen, Zeichnungen, Grafiken sowie Skulpturen und 20% bei Fotografien und allen anderen Objekten. Bei Differenzbesteuerung beträgt das Aufgeld 28%. Die Umsatzsteuer ist bei der Differenzbesteuerung inkludiert.
ROBERT PHILIPPI* (Graz 1877 - 1959 Wien)Hl. SebastianLithografie/Papier 47,5 x 35,5 cmsigniert Philippimonogrammiert RPH im Druckverso Nachlassstempel RPHBlattmaß 70,5 x 50,3 cmSCHÄTZPREIS / ESTIMATE °€ 150 - 250STARTPREIS / STARTING PRICE °€ 150Der österreichische Maler Robert Philippi erhielt die erste künstlerische Ausbildung beim Theatermaler Robert Kautsky und in der privaten Wiener Malschule Streblow. 1893 bis 1896 studierte er an der Wiener Akademie bei Christian Griepenkerl und Josef Mathias Trenkwald und später an der Kunstgewerbeschule Wien bei Felician Myrbach und Alfred Roller. An der Kunstgewerbeschule wurde er 1914 Assistent von Franz Čižek. Vermutlich war er auch Schüler am Weimarer Bauhaus. Nach Anfängen in der Zeichnung und im Holzschnitt und wandte sich Philippi ab 1925 verstärkt der Malerei zu. Philippi stand unter dem Einfluss von Gustav Klimt und war bis 1925 Mitglied im Hagenbund, Wien.Bitte beachten: Der Kaufpreis besteht aus Meistbot zuzüglich des Aufgeldes, der Umsatzsteuer sowie gegebenenfalls der Folgerechtsabgabe. Bei Normalbesteuerung (mit ° beim Schätzpreis gekennzeichnet) kommt auf das Meistbot ein Aufgeld in der Höhe von 24% hinzu. Auf die Summe von Meistbot und Aufgeld kommt die gesetzliche Umsatzsteuer hinzu. Diese beträgt 13% bei Gemälden, Aquarellen, Zeichnungen, Grafiken sowie Skulpturen und 20% bei Fotografien und allen anderen Objekten. Bei Differenzbesteuerung beträgt das Aufgeld 28%. Die Umsatzsteuer ist bei der Differenzbesteuerung inkludiert.
JOSEF HOFFMANN* (Pirnitz 1870 - 1956 Wien)VasenentwurfBleistift/Papier 29,8 x 21,1 cmmonogrammiert JHbeschriftet Bund, verso nummeriert 9SCHÄTZPREIS / ESTIMATE °€ 250 - 500STARTPREIS / STARTING PRICE °€ 250Josef Hoffmann, Schüler von Otto Wagner, war als Architekt und Gestalter eine der zentralen Figuren der Wiener Moderne. 1903 gründete er mit Koloman Moser und dem Industrielle Fritz Waerndorfer die Wiener Werkstätte (WW), nach dem Vorbild der britischen Arts and Crafts Movement und unter dem Eindruck des Wiener Jugendstils. Hoffmann, befreundet u. a. mit Gustav Klimt und Anton Hanak, blieb bis zum Konkurs 1932 einer der wichtigsten Gestalter der WW. Die Wiener Werkstätte, bezeichnet auch als Wiener Werkstatt, Vienna Workshop, Wiener Werkstaetten oder Wiener Werkstätten, hatte die Zielsetzung, die gesamten Lebensbereiche des Menschen gestalterisch zu vereinen, im Sinne eines Gesamtkunstwerks. Zu den Kunden zählten hauptsächlich Künstler und die aufstrebende jüdische Ober- und Mittelschicht. Die Bekanntschaft Josef Hoffmanns mit Berta Zuckerkandl führte zum ersten großen Auftrag: dem Sanatorium Purkersdorf, von Viktor Zuckerkandl, Bertas Schwager, westlich von Wien geplant. Unter den Mitarbeitern der WW war auch rund ein Dutzend Frauen, die entscheidend für den Stilwandel vom Jugendstil zum Art Déco der 20er-Jahre waren, z. B. Vally Wieselthier, Gudrun Baudisch, Reni Schaschl, Hilda Jesser und Susi Singer. Die NS-Zeit überstand Josef Hoffmann trotz Anfeindungen des NS-Architekturideologen Paul Schmitthenner unbeschadet. Von der Reichskammer der bildenden Künste wurde er beauftragt, als künstlerischer Leiter den Wiener Kunsthandwerksverein (eine NS-Nachfolgeorganisation des Österreichischen Werkbundes) weiterzuentwickeln. Zu diesem Zweck wurde 1941 eine „künstlerische Versuchsanstalt“ gegründet, in der junge Kunsthandwerker sich unter Hoffmanns Anleitung weiterbilden konnten. Nach dem Krieg, 1948, gründete Hoffmann die Österreichischen Werkstätten als Nachfolgerin von Wiener Werkstätte und Werkbund (ÖWB), dem er bis 1920 angehört hatte. Hoffmanns Grabstein wurde von Fritz Wotruba gestaltet.Bitte beachten: Der Kaufpreis besteht aus Meistbot zuzüglich des Aufgeldes, der Umsatzsteuer sowie gegebenenfalls der Folgerechtsabgabe. Bei Normalbesteuerung (mit ° beim Schätzpreis gekennzeichnet) kommt auf das Meistbot ein Aufgeld in der Höhe von 24% hinzu. Auf die Summe von Meistbot und Aufgeld kommt die gesetzliche Umsatzsteuer hinzu. Diese beträgt 13% bei Gemälden, Aquarellen, Zeichnungen, Grafiken sowie Skulpturen und 20% bei Fotografien und allen anderen Objekten. Bei Differenzbesteuerung beträgt das Aufgeld 28%. Die Umsatzsteuer ist bei der Differenzbesteuerung inkludiert.
JOSEF HOFFMANN* (Pirnitz 1870 - 1956 Wien)Entwurf TeeserviceTinte/Papier 42,1 x 59,6 cmbeschriftet Aauf Karton montiertSCHÄTZPREIS / ESTIMATE °€ 600 - 1200STARTPREIS / STARTING PRICE °€ 600Josef Hoffmann, Schüler von Otto Wagner, war als Architekt und Gestalter eine der zentralen Figuren der Wiener Moderne. 1903 gründete er mit Koloman Moser und dem Industrielle Fritz Waerndorfer die Wiener Werkstätte (WW), nach dem Vorbild der britischen Arts and Crafts Movement und unter dem Eindruck des Wiener Jugendstils. Hoffmann, befreundet u. a. mit Gustav Klimt und Anton Hanak, blieb bis zum Konkurs 1932 einer der wichtigsten Gestalter der WW. Die Wiener Werkstätte, bezeichnet auch als Wiener Werkstatt, Vienna Workshop, Wiener Werkstaetten oder Wiener Werkstätten, hatte die Zielsetzung, die gesamten Lebensbereiche des Menschen gestalterisch zu vereinen, im Sinne eines Gesamtkunstwerks. Zu den Kunden zählten hauptsächlich Künstler und die aufstrebende jüdische Ober- und Mittelschicht. Die Bekanntschaft Josef Hoffmanns mit Berta Zuckerkandl führte zum ersten großen Auftrag: dem Sanatorium Purkersdorf, von Viktor Zuckerkandl, Bertas Schwager, westlich von Wien geplant. Unter den Mitarbeitern der WW war auch rund ein Dutzend Frauen, die entscheidend für den Stilwandel vom Jugendstil zum Art Déco der 20er-Jahre waren, z. B. Vally Wieselthier, Gudrun Baudisch, Reni Schaschl, Hilda Jesser und Susi Singer. Die NS-Zeit überstand Josef Hoffmann trotz Anfeindungen des NS-Architekturideologen Paul Schmitthenner unbeschadet. Von der Reichskammer der bildenden Künste wurde er beauftragt, als künstlerischer Leiter den Wiener Kunsthandwerksverein (eine NS-Nachfolgeorganisation des Österreichischen Werkbundes) weiterzuentwickeln. Zu diesem Zweck wurde 1941 eine „künstlerische Versuchsanstalt“ gegründet, in der junge Kunsthandwerker sich unter Hoffmanns Anleitung weiterbilden konnten. Nach dem Krieg, 1948, gründete Hoffmann die Österreichischen Werkstätten als Nachfolgerin von Wiener Werkstätte und Werkbund (ÖWB), dem er bis 1920 angehört hatte. Hoffmanns Grabstein wurde von Fritz Wotruba gestaltet.Bitte beachten: Der Kaufpreis besteht aus Meistbot zuzüglich des Aufgeldes, der Umsatzsteuer sowie gegebenenfalls der Folgerechtsabgabe. Bei Normalbesteuerung (mit ° beim Schätzpreis gekennzeichnet) kommt auf das Meistbot ein Aufgeld in der Höhe von 24% hinzu. Auf die Summe von Meistbot und Aufgeld kommt die gesetzliche Umsatzsteuer hinzu. Diese beträgt 13% bei Gemälden, Aquarellen, Zeichnungen, Grafiken sowie Skulpturen und 20% bei Fotografien und allen anderen Objekten. Bei Differenzbesteuerung beträgt das Aufgeld 28%. Die Umsatzsteuer ist bei der Differenzbesteuerung inkludiert.
EMILIE MEDIZ-PELIKAN (Vöcklabruck 1861 - 1908 Dresden)Sitzender weiblicher AktBleistift/Papier 34,8 x 22 cmSignaturstempel Em PelikanSCHÄTZPREIS / ESTIMATE °€ 300 - 600STARTPREIS / STARTING PRICE °€ 300Österreichische Landschaftsmalerin. Hielt sich in der Künstlerkolonie Dachau und der Künstlerkolonie Knokke auf, stellte in der Wiener Secession und im Hagenbund aus. War verheiratet mit Karl Mediz. Die Küstlerin Gertrude Hnzatko-Mediz war eine Tochter des Paares. Stilistisch ist Mediz-Pelikan einzuordnen zwischen Jugendstil, Symbolismus, Stimmungsimpressionismus und Impressionismus. Schuf Zeichnungen und Druckgrafik mit Landschaften wie die Birken von Gustav Klimt. Gehört zu den bedeutenden österreichischen Künstlerinnen wie Tina Blau, Olga Wisinger-Florian und Marie Egner. Im Gesamtœuvre der in Vöcklabruck gebürtigen Künstlerin Emilie Mediz-Pelikan, nehmen Landschaften eine zentrale Stellung ein. Sie wurde mit 21 die letzte Privatschülerin des bereits hochbetagten Landschaftsmalers Albert Zimmermann. Mediz-Pelikan studierte an der Wiener Akademie und folgte Albert Zimmermann nach Salzburg und München. 1891 heiratete sie den Maler und Grafiker Karl Mediz, mit dem sie zuerst in Wien und ab 1894 in Dresden lebte. Sie stand in Kontakt zur Dachauer Künstlerkolonie und unternahm Studienreisen nach Paris, Belgien, Ungarn und Italien. Erst um 1900 gelang ihr mit ihren Landschaftsbildern der künstlerische Durchbruch. Da der Nachlass der 1908 in Dresden frühzeitig verstorbenen Künstlerin bis in die 1980er Jahre in der DDR gelagert war, kam es erst relativ spät zur Neuentdeckung und Wiederbewertung der Künstlerin, sowohl in der österreichischen Kunstgeschichte als auch am Kunstmarkt. 1986 kam es zu ersten großen Ausstellungen im Oberösterreichischen Landesmuseum und in der Hochschule für angewandte Kunst in Wien. Wie viele impressionistische Malerinnen setzte sich Emilie Mediz-Pelikan von Beginn ihrer künstlerischen Tätigkeit an intensiv mit der Natur und deren Veränderlichkeit auseinander. Oft sind ihre Werke in eine entrückte Atmosphäre eingetaucht. Das von ihr – und von ihrem Mann – oft verwendete Motiv der Birken findet sich später auch in Darstellungen bei Klimt, Baar oder Junk wieder. In einem Brief an ihren Mann aus dem Jahr 1893 beschreibt sie ihre Reise ins böhmische Chotěboř sowie die Schönheit der Bäume in dieser Gegend. Beim Durchblättern der Korrespondenz zwischen dem Ehepaar wird die zentrale Bedeutung der Natur sofort spürbar. Ausführlich sind die Beschreibungen der Landschaft und ihrer Vegetation, die Mediz-Pelikan auch detailreich in Skizzen festhielt. Eindrucksvolle Arbeiten entstanden auch bei Reisen ans Adriatische Meer, an Küstenorten wie Duino oder Dubrovnik (Lacroma).Bitte beachten: Der Kaufpreis besteht aus Meistbot zuzüglich des Aufgeldes, der Umsatzsteuer sowie gegebenenfalls der Folgerechtsabgabe. Bei Normalbesteuerung (mit ° beim Schätzpreis gekennzeichnet) kommt auf das Meistbot ein Aufgeld in der Höhe von 24% hinzu. Auf die Summe von Meistbot und Aufgeld kommt die gesetzliche Umsatzsteuer hinzu. Diese beträgt 13% bei Gemälden, Aquarellen, Zeichnungen, Grafiken sowie Skulpturen und 20% bei Fotografien und allen anderen Objekten. Bei Differenzbesteuerung beträgt das Aufgeld 28%. Die Umsatzsteuer ist bei der Differenzbesteuerung inkludiert.
JOSEF HOFFMANN* (Pirnitz 1870 - 1956 Wien)Entwurf für einen Deckelpokal, 1946Bleistift/Papier 29,7 x 21 cmmonogrammiert JH, datiert 46Atelierstempel Josef Hoffmannverso Atelierstempel Josef Hoffmann und Nennung ausführender BetriebeSCHÄTZPREIS / ESTIMATE °€ 300 - 600STARTPREIS / STARTING PRICE °€ 300Josef Hoffmann, Schüler von Otto Wagner, war als Architekt und Gestalter eine der zentralen Figuren der Wiener Moderne. 1903 gründete er mit Koloman Moser und dem Industrielle Fritz Waerndorfer die Wiener Werkstätte (WW), nach dem Vorbild der britischen Arts and Crafts Movement und unter dem Eindruck des Wiener Jugendstils. Hoffmann, befreundet u. a. mit Gustav Klimt und Anton Hanak, blieb bis zum Konkurs 1932 einer der wichtigsten Gestalter der WW. Die Wiener Werkstätte, bezeichnet auch als Wiener Werkstatt, Vienna Workshop, Wiener Werkstaetten oder Wiener Werkstätten, hatte die Zielsetzung, die gesamten Lebensbereiche des Menschen gestalterisch zu vereinen, im Sinne eines Gesamtkunstwerks. Zu den Kunden zählten hauptsächlich Künstler und die aufstrebende jüdische Ober- und Mittelschicht. Die Bekanntschaft Josef Hoffmanns mit Berta Zuckerkandl führte zum ersten großen Auftrag: dem Sanatorium Purkersdorf, von Viktor Zuckerkandl, Bertas Schwager, westlich von Wien geplant. Unter den Mitarbeitern der WW war auch rund ein Dutzend Frauen, die entscheidend für den Stilwandel vom Jugendstil zum Art Déco der 20er-Jahre waren, z. B. Vally Wieselthier, Gudrun Baudisch, Reni Schaschl, Hilda Jesser und Susi Singer. Die NS-Zeit überstand Josef Hoffmann trotz Anfeindungen des NS-Architekturideologen Paul Schmitthenner unbeschadet. Von der Reichskammer der bildenden Künste wurde er beauftragt, als künstlerischer Leiter den Wiener Kunsthandwerksverein (eine NS-Nachfolgeorganisation des Österreichischen Werkbundes) weiterzuentwickeln. Zu diesem Zweck wurde 1941 eine „künstlerische Versuchsanstalt“ gegründet, in der junge Kunsthandwerker sich unter Hoffmanns Anleitung weiterbilden konnten. Nach dem Krieg, 1948, gründete Hoffmann die Österreichischen Werkstätten als Nachfolgerin von Wiener Werkstätte und Werkbund (ÖWB), dem er bis 1920 angehört hatte. Hoffmanns Grabstein wurde von Fritz Wotruba gestaltet.Bitte beachten: Der Kaufpreis besteht aus Meistbot zuzüglich des Aufgeldes, der Umsatzsteuer sowie gegebenenfalls der Folgerechtsabgabe. Bei Normalbesteuerung (mit ° beim Schätzpreis gekennzeichnet) kommt auf das Meistbot ein Aufgeld in der Höhe von 24% hinzu. Auf die Summe von Meistbot und Aufgeld kommt die gesetzliche Umsatzsteuer hinzu. Diese beträgt 13% bei Gemälden, Aquarellen, Zeichnungen, Grafiken sowie Skulpturen und 20% bei Fotografien und allen anderen Objekten. Bei Differenzbesteuerung beträgt das Aufgeld 28%. Die Umsatzsteuer ist bei der Differenzbesteuerung inkludiert.
ALOIS KALVODA (Czech / Bohemian 1875 - 1934) - Birch grove | around 1905 | technique: oil on canvas | 30.5 x 31 cm | signature: bottom right | framed | Lot description | The painting is an exceptional example of Art Nouveau landscape painting, where the emphasis is on the decorative stylization of nature. This square format, which is typical for Art Nouveau, refers to the composition and aesthetics that we can also observe in the works of Gustav Klimt or Carl Moll. As with Klimt and Moll, Kalvoda in this work captures nature not as a realistic view, but as a harmonious pattern of lines and colors. The depiction of a birch grove with significant use of light and shadow creates an almost ornamental character that evokes a sense of calm and well-being, typical of art nouveau painting. Here, Kalvoda perfectly follows the Art Nouveau principles and depicts the landscape not only as a place, but as an emotional and aesthetic experience. | condition report*In case of missing photos, please feel free to contact us.
Franz Blei Die Hetärengespräche des Lukian. Deutsch von Franz Blei. Leipzig, J. Zeitler 1907. Zeitlers kühne Ausgabe der Hetärengespräche des Lukian, genial illustriert von Gustav Klimt. 1 von 450 nummerierten Exemplaren. Schöner breitrandiger Druck auf chamoisfarbenem Bütten; die Zeichnungen in Faksimile-Lichtdruck. Die Hetärengesprächen des Lukian (von Samosata), um 160 n. Chr. verfaßt, behandeln in 15 Dialogen die Geschichten aus dem Leben gebildeter Sexarbeiterinnen (sog. Hetären) im antiken Griechenland. Er gilt als einer der bedeutendsten Satiriker der griechischen Antike. Gustav Klimts (meist erotische) Illustrationen, stammen aus einer Vorserie zu seinen beiden berühmten Gemälden Wasserschlangen (1904-1907). Die Gestaltung des Einbandes übernahm Josef Hoffmann (1870–1956) von der Wiener Werkstätte. EINBAND: Orig.-Leinenband mit goldgeprägtem Deckeltitel. 37,2 : 29,5 cm. - ILLUSTRATION: Mit 15 Tafeln von Gustav Klimt. LITERATUR: Hayn/Got. IV, 294: 'Luxuriöse Ausgabe'. - Schauer I, 158. - Eyssen S. 168 und 177. 1 of 450 numb. copies. - Fine and broad-margined print on creme laid paper; drawings in facsimile heliotype. With 15 plates by G. Klimt. Orig. cloth from the Wiener Werkstätte with gilted cover title. - Endpapers sunned, front inner joint somewhat torn. Edges hardly rubbed, spine ends lightly faded. - All in all fine copy. Vollständige Beschreibung und Zustandsbericht https://www.ketterer-rarebooks.de/kunst/kd/details.php?detail=1&anummer=559&obnr=424000317 Dieses Objekt wird regel- oder differenzbesteuert angeboten. Complete description and condition report https://www.ketterer-rarebooks.com/details-e.php?detail=1&anummer=559&obnr=424000317 This lot can be purchased subject to differential or regular taxation.
VITTORIO ZECCIN (1866 - 1947, Murano) An der KathedraleÖl auf Malkarton.21,3 x 29,7 cm. Unten rechts mit Pinsel in Rot signiert "V Zeccin".Verso eine Ölstudie einer Stadt am Fluss.Der in Murano geborene Vittorio Zeccin, dessen Vater in einer Glasmanufaktur arbeitete, hatte zu Beginn seiner künstlerischen Laufbahn kein Interesse an der Glaskunst und studierte zunächst Malerei an der Accademia di Belle Arti in Venedig. Fasziniert von der aktuellen mystischen und symbolischen Malerei sowie der Jugendstilbewegung reiste er um 1910 nach Wien, um die Künstler und ihre Werke vor Ort kennenzulernen. Dort taf er Gustav Klimt, der einen nachhaltigen Einfluss auf sein Schaffen haben sollte.Erst ab 1918 beginnt er sich doch mehr und mehr für die Glaskunst und die angewandten Künste zu interessieren und entwickelt im Laufe der Zeit Glaskunstwerke von beeindruckender Leichtigkeit und zarter Farbigkeit.
Oskar Kokoschka. Die traeumenden Knaben. Wien, Wiener Werkstätte 1908. Mit acht farbigen Lithographien und drei Strichätzungen, davon eine als Deckelvignette. Golddurchwirkter Originalleinenband mit montierter Deckelvignette und Kordelheftung. In Leinenkassette mit Lederrückenschild.Eins von 225 Exemplaren, die im Originaleinband der Wiener Werkstätte ausgeliefert wurde. Auf dem Widmungsblatt mit eigenhändiger Widmung des Künstlers, »für [M. Mell] O Kokoschka«. Der Name des Bedachten wurde später ausradiert, ist jedoch unter Streiflicht und Lupe sichtbar. Max Mell (österreichischer Dichter und Publizist, 1882-1971) kannte Kokoschka aus der gemeinsamen Arbeit im Wiener Kabarett Fledermaus. Für eine Rezension der »Träumenden Knaben« sandte ihm Kokoschka Korrekturbögen zu (Brief an Max Mell, Juni 1908). Kurze Zeit später erschien Kokoschkas überschwängliche Rezension unter dem Titel »Chaos der Kindheit« in der Berliner Zeitschrift »Die Zukunft«. - Gut vorstellbar, dass ihm der dankbare junge Kokoschka daraufhin ein Exemplar seines Buches widmete, ebenso denkbar auch, dass Max Mell, der sich bereits 1933 von den Kritikern der Bücherverbrennung abwandte und später als Präsident des »Bundes Deutscher Schriftsteller« den Anschluss Österreichs an Hitlerdeutschland begeistert begrüßte, seine frühere Beziehung zu dem inzwischen als »entartet« diffamierten Kokoschka leugnen und verbergen wollte.Erste Veröffentlichung Kokoschkas, gewidmet seinem Lehrer Gustav Klimt. 1907 erhielt er vom damaligen Leiter der Wiener Werkstätte Fritz Waerndorfer den Auftrag, »ein Kinderbuch zu zeichnen; es sollten farbige Lithographien sein. »Jedoch nur im ersten Blatt hielt ich mich an die Aufgabe. Die anderen Blätter entstanden dann mit meinen Versen als freie Bilddichtung« (OK, Mein Leben). - Das Buch schildert die Begegnung mit dem Mädchen Li, hinter dem sich Lilith Lang (»die ich sehr liebte«), die Schwester eines Mitschülers und wie Kokoschka Studentin an der Kunstgewerbeschule, verbarg. »Eben bringt Kokoschka sein Märchenbuch, fertig und mit Text [...] Weg du Popanz meines sündhaften Vorbehalts. Helle Feuer liegen an den Zwergenwäldern. [...] Na servus, und das ist der Lehrer meiner Kindheit. Aber die Bilder sind glänzend.« (Fritz Waernsdorfer an den Künstler Carl Otto Czeschka). - Gedruckt wurden in Wien in den Offizinen Berger (Farblithographien) und Chwala (typographischer Text, Widmungsblatt und die beiden Vignetten) 500 Exemplare. Aufgrund der geringen Nachfrage wurden jedoch nur 225 Exemplare aufgebunden, Kurt Wolff erwarb später die Restauflage der noch ungebundenen Lithographien. - Sehr schönes, makelloses Exemplar mit bedeutender Provenienz.24,3 : 29,8 cm. [10] Blätter.Wingler/Welz 22-29. - Jentsch 1. - Garvey 147. - Castleman 35. - Papiergesänge 19.- Schweiger Seite 47ff.
Wien - Die Wiener Werkstätte 1903-1928. Modernes Kunstgewerbe und sein Weg. Wien, Krystall Verlag 1929. Mit 175, teils farbigen Abbildungen. Originaleinband (signiert: Karl Scheibe, Wien) mit bemalter Reliefpressung. Im Schuber.Erste und einzige Ausgabe. - Sehr schöne von Mathilde Flögl nach Angaben von Josef Hoffmann gestaltete Festschrift, erschienen im Jubiläumsjahr der Werkstätte. - Außergewöhnlich schönes Exemplar. - Die beiden orange und schwarz bemalten Pappmachéreliefs auf Vorder- und Hinterdeckel des berühmten Einbands wurden von Vally Wieselthier bzw. Gudrun Baudisch entworfen. - »Das Neue an diesem [...] Album ist der Umstand, daß darin jede einzelne Seite nach künstlerischem Gesichtspunkt komponiert ist und zur Belebung der Blattfläche auch Farben (Schwarz, Rot, Gold und Silber) zur Verwendung kamen« (Buchanzeige 1929, zitiert nach Schweiger). - In 175 Abbildungen wird ein Querschnitt durch das künstlerische Schaffen und die Erzeugnisse (Kunstgegenstände, Stoffe, Bucheinbände, Schmuck, Möbel u. a.) der Wiener Werkstätte gegeben, vertreten sind alle Protagonisten der Wiener Moderne: Gustav Klimt, Josef Hoffmann, Dagobert Peche, Koloman Moser, Fritz Waerndorfer u. v. a. - Mit dem bibliographischen Beilageblatt. - »Ein »als ›Kachel-Katalog‹ gehandeltes Rarissimum des Antiquariatsbuchhandels« (Brandstätter). - Sehr schönes Exemplar, der empfindliche Einband durch eine angemessen aufwändige, passend zweifarbige Lederkassette geschützt.23,0 : 21,8 cm. [148] Seiten bzw. Tafeln.Dokumentations-Bibliothek VI, 485. - Schweiger S. 124f. - Brandstätter 13
40 Original Athena posters - Various themes, all printed on paper stock, flat, various sizes, mainly 35 x 23.5 inches. Running Horse, 1984, artworks by Jan Huston at Michael Woodward Associates, printed on paper stock, flat, 35 x 23.5 inches; Sunday Supper, 1982 Tony Stone Photo Library, printed on paper stock, flat, 35 x 23.5 inches; The Team, 1982 - Photography by Tony Stone Associates, printed on paper stock, flat, 35 x 23.5 inches; Dream Horses, 1975 - W&S Fotographi, printed on paper stock, flat, 35 x 23.5 inches; The Boss, 1982, printed on paper stock, flat, 35 x 23.5 inches; Uncle Albert, 1982, Boisgibault, 1981, Sancere from Les Nues, 1981, artworks by Ha Van Vuong; La Grande Rue, 1980, Galerie De La Presidence, 1979, artworks by M. De Gallard; Woodland Water, 1979, Frosty Stile, 1981, Meadowlands, 1981, artworks by Colin Paynton; Morning Calm, 1978, artwork by E J Spencer; Thai Fisherman, 1979, Man Of La Mancha, 1980, artworks by Frank Paynton; Blue Model (aka Blue Nude), artwork by Pablo Picasso; The Luncheon Of The Boating Party, Path Climbing Through Long Grass, 1874, artworks by Pierre Auguste Renoir; Hunters In The Snow, artwork by Pieter Brueghel; Peach Tree, artwork by Vincent Van Gogh.Les Grandes Baigneuses, - artwork by Auguste Renoir; Road With Cypress And Star, 1890, artwok by Vincent Van Gogh; Lithograph Originales, - artwork by Georges De Feure; Expectation, - artwork by Gustav Klimt; Evening Tide, 1979, - artwork by James Spencer; The Butterfly Ferry, The Nightingale, - artworks by Ida Outhwaite; Mona Lisa, - artwork by Leonardo Da Vinci; A Bar At The Folies-Bergere, - artwork by Edouard Manet; Metamorphosis Of Narcissus, - artwork by Salvador Dali; Hylas And The Nymphs, Echo And Narcissus, - artworks by John Waterhouse; Carnival Evening, 1866, - artwork by Henri Rousseau; Ville De Avray, Jean Corot; Jane Avril, - artwork by Toulouse-Lautrec; Dawn Anchorage, 1980, - artwork by Jim Spencer; Cheetahs, 1984, Prowling Tiger, 1984, artworks by Jan Huston at Michael Woodward Associates, Wine, 1983, Cocktails, 1983, - artworks by Jim Spencer
-
1331 item(s)/page